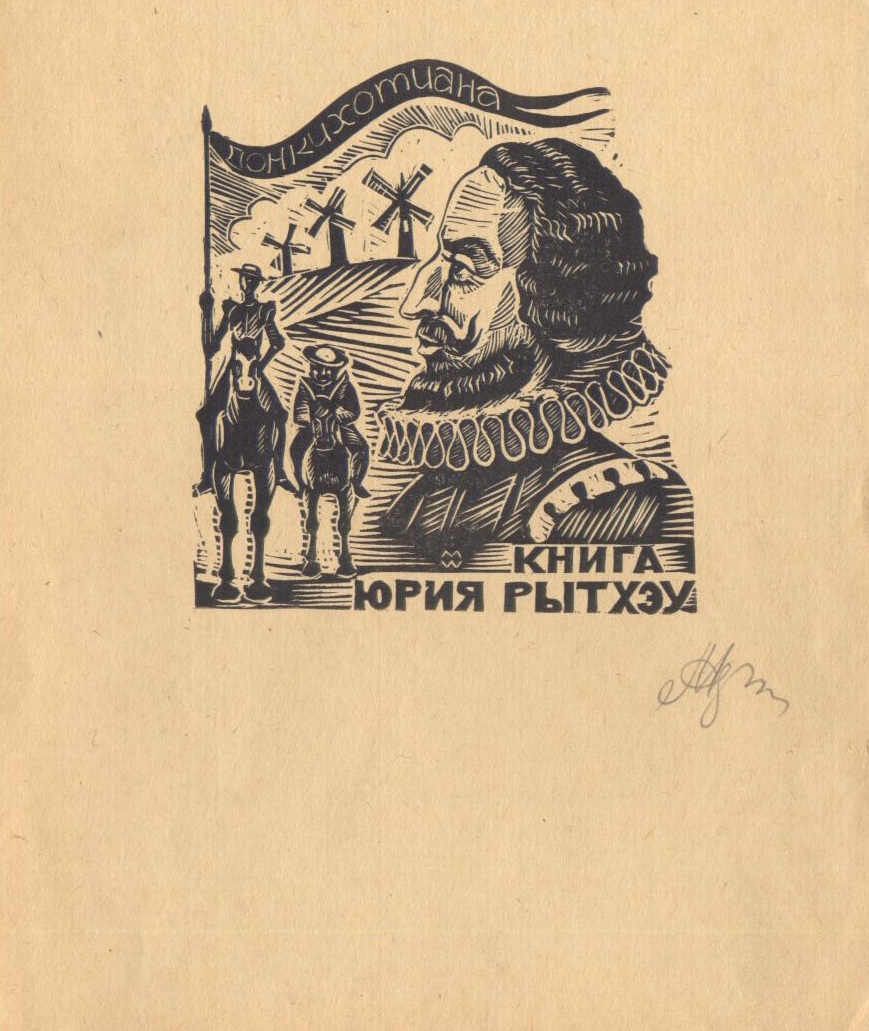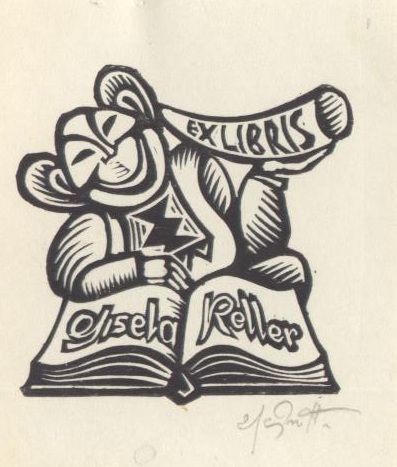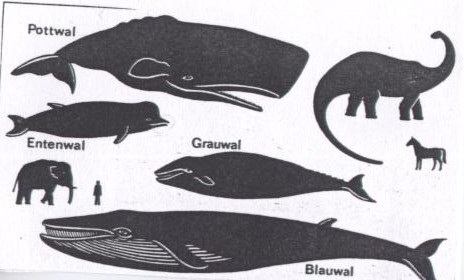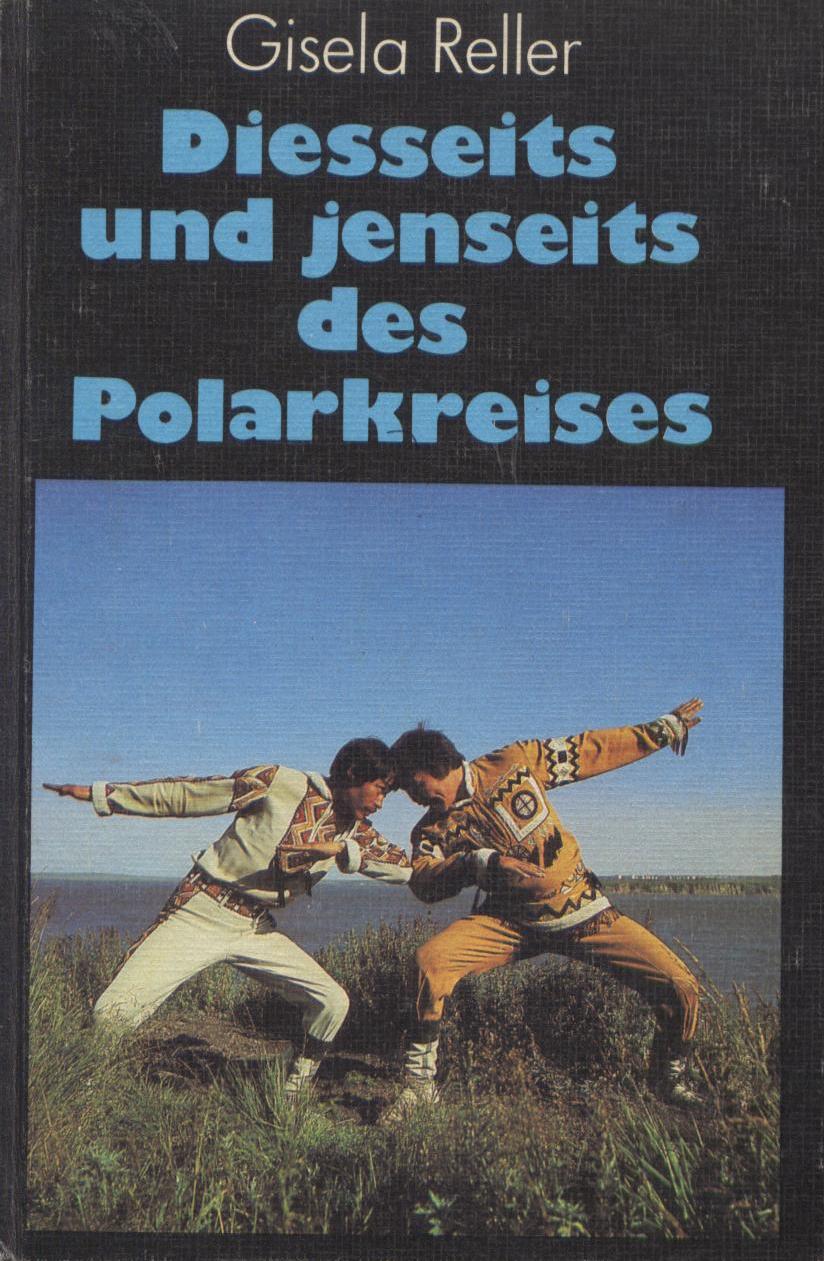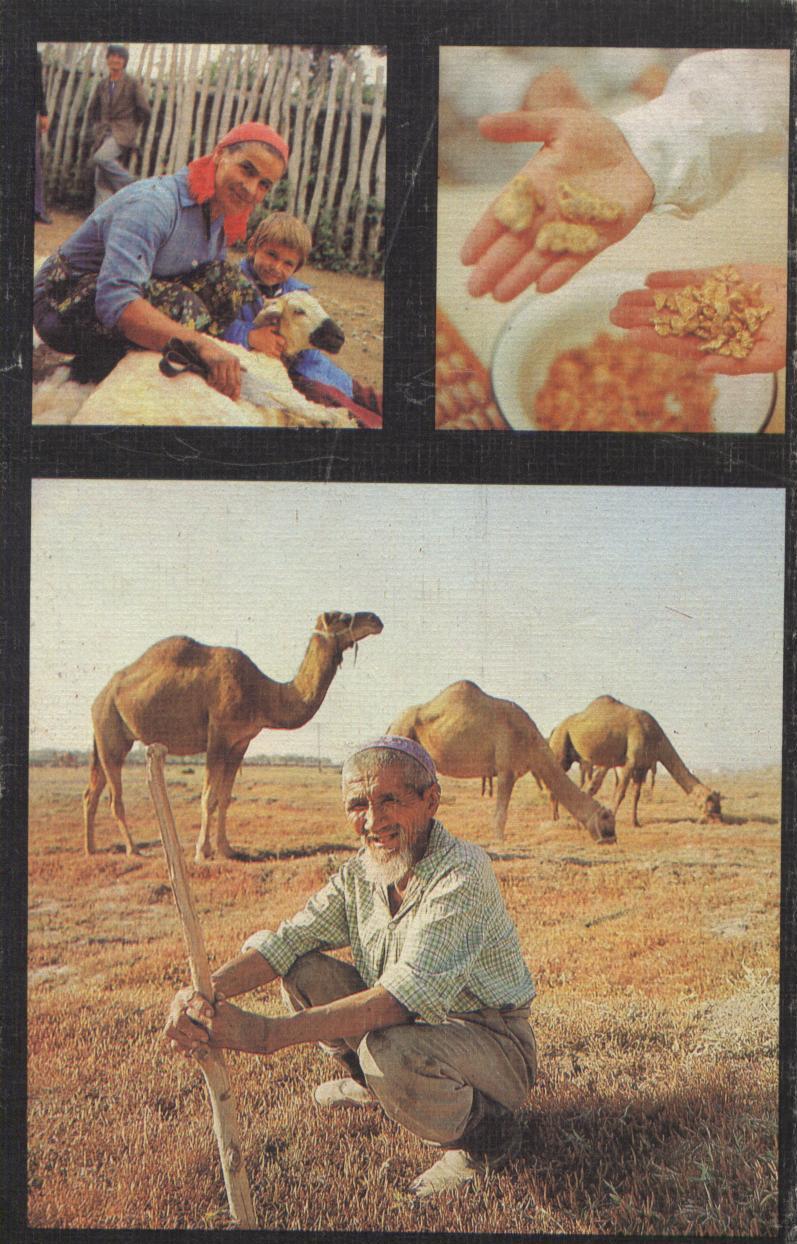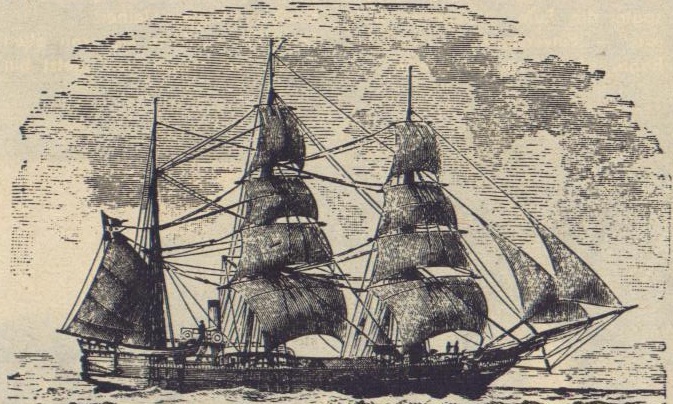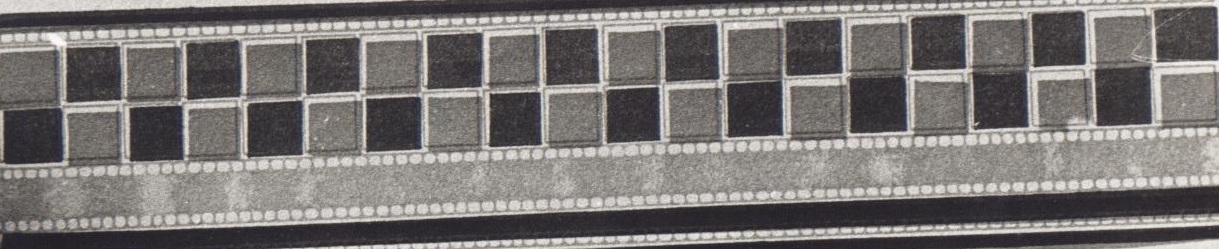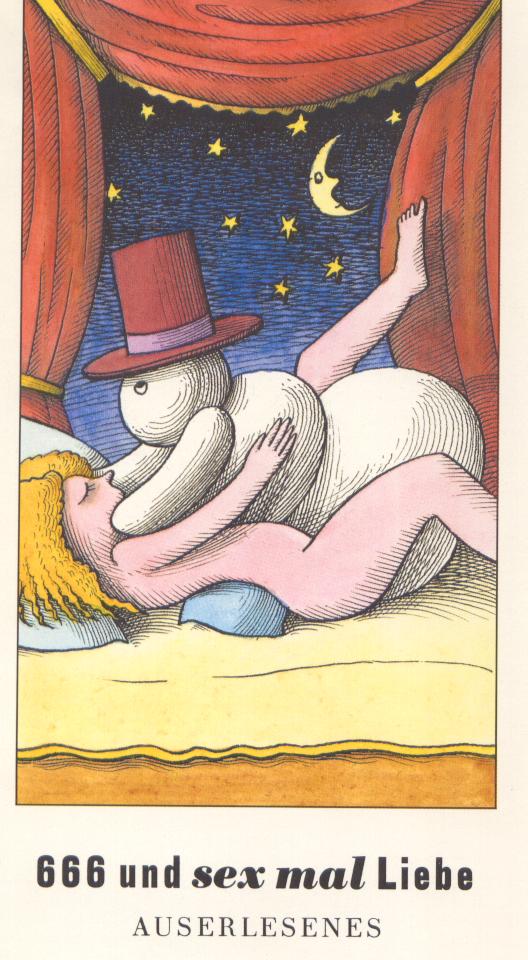Vorab!
Leider kommt im Internet bei meinem
(inzwischen veralteten) FrontPage-Programm
längst nicht alles so, wie von mir in html angegeben. Farben kommen anders, als
von mir geplant, Satzbreiten wollen nicht so wie von mir markiert, Bilder kommen
manchmal an der falschen Stelle, und - wenn ich Pech habe -
erscheint statt des Bildes gar eine
Leerstelle.
Was tun? Wer kann helfen?
*
Wird laufend bearbeitet!
Ich bin eine TSCHUKTSCHIN: Die
Märchenerzählerin Olga Rachtyn.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Zeichnung: Karl-Heinz
Döhring
"Die Seele, denke ich, hat keine Nationalität."
Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930
bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007
Wenn wir für das eine Volk eine
Zuneigung oder gegen das andere eine Abneigung hegen, so beruht das, ob wir uns
dessen bewusst sind oder nicht, auf dem, was wir von dem jeweiligen Volk wissen
oder zu wissen glauben. Das ist – seien wir ehrlich – oft sehr wenig, und
manchmal ist dieses Wenige auch noch falsch.
Ich habe für die Berliner
Illustrierte FREIE WELT jahrelang die
Sowjetunion bereist, um – am liebsten - über abwegige Themen zu berichten: über Hypnopädie und Suggestopädie, über Geschlechtsumwandlung und Seelenspionage,
über Akzeleration und geschlechtsspezifisches Kinderspielzeug... Außerdem habe
ich mit jeweils einem deutschen und einem Wissenschaftler aus dem weiten
Sowjetland vielteilige Lehrgänge erarbeitet.* Ein sehr
interessantes Arbeitsgebiet! Doch 1973, am letzten Abend meiner Reise nach
Nowosibirsk – ich hatte viele Termine in Akademgorodok, der russischen Stadt der
Wissenschaften – machte ich einen Abendspaziergang entlang des Ob. Und plötzlich
wurde mir klar, dass ich zwar wieder viele Experten kennengelernt hatte, aber
mit der einheimischen Bevölkerung kaum in Kontakt gekommen war.
Da war in einem magischen Moment an
einem großen sibirischen Fluss - Angesicht in Angesicht mit einem kleinen (grauen!)
Eichhörnchen - die große FREIE WELT-Völkerschafts-Serie** geboren!
Und nun reiste ich ab 1975 jahrzehntelang
zu zahlreichen Völkern des Kaukasus, war bei vielen Völkern Sibiriens, war in
Mittelasien, im hohen Norden, im Fernen Osten und immer wieder auch bei den
Russen.
Nach dem Zerfall der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken zog es mich – nach der wendegeschuldeten
Einstellung der FREIEN WELT***, nun als Freie Reisejournalistin – weiterhin in die mir
vertrauten Gefilde, bis ich eines Tages mehr über die westlichen Länder und
Völker wissen wollte, die man mir als DDR-Bürgerin vorenthalten hatte.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist
nun mein Nachholebedarf erst einmal gedeckt, und ich habe das Bedürfnis, mich
wieder meinen heißgeliebten Tschuktschen, Adygen, Niwchen, Kalmyken und Kumyken,
Ewenen und Ewenken, Enzen und Nenzen... zuzuwenden.
Deshalb werde ich meiner Webseite
www.reller-rezensionen.de (mit inzwischen
weit mehr als fünfhundert Rezensionen), die
seit 2002 im Netz ist, ab 2013 meinen journalistischen
Völkerschafts-Fundus von fast einhundert Völkern an die Seite stellen – mit ausführlichen geographischen und
ethnographischen Texten, mit Reportagen, Interviews, Sprichwörtern, Märchen,
Gedichten, Literaturhinweisen, Zitaten aus längst gelesenen und neu erschienenen
Büchern; so manches davon, teils erstmals ins Deutsche übersetzt, war bis jetzt
– ebenfalls wendegeschuldet – unveröffentlicht geblieben.
Sollten sich in meinem Material
Fehler oder Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, teilen Sie mir diese bitte am
liebsten in meinem Gästebuch oder per E-Mail
gisela@reller-rezensionen.de
mit. Überhaupt würde ich mich über
eine Resonanz meiner Nutzer freuen!
Gisela Reller
* Lernen Sie Rationelles Lesen" / "Lernen
Sie lernen" / "Lernen Sie reden" / "Lernen Sie essen" / "Lernen Sie, nicht
zu rauchen" / "Lernen Sie schlafen" / "Lernen Sie logisches Denken"...
** Im 1999 erschienenen Buch
„Zwischen `Mosaik´ und `Einheit´. Zeitschriften in der DDR“ von Simone Barck,
Martina Langermann, Siegfried Lokatis (Hrsg.), erschienen im Berliner Ch. Links
Verlag, ist eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass
die Völkerschaftsserie
der FREIEN WELT von neun vorgegebenen Themenkreisen
an zweiter Stelle in der Gunst der Leser stand – nach „Gespräche mit
Experten zu aktuellen Themen“.
(Quelle: ZA Universität
Köln, Studie 6318)
***
Christa Wolf
zur Einstellung der Illustrierten FREIE WELT in ihrem Buch "Auf dem Weg nach Tabou, Texte 1990-1994", Seite 53/54:
„Aber auf keinen Fall möchte ich den Eindruck
erwecken, in dieser Halbstadt werde nicht mehr gelacht. Im Gegenteil! Erzählt
mir doch neulich ein Kollege aus meinem Verlag (Helmut Reller) – der natürlich
wie zwei Drittel der Belegschaft längst entlassen ist –, daß nun auch seine Frau
(Gisela Reller), langjährige Redakteurin einer Illustrierten (FREIE WELT)
mitsamt der ganzen Redaktion gerade gekündigt sei: Die Zeitschrift werde
eingestellt. Warum wir da so lachen mußten? Als im Jahr vor der `Wende´ die
zuständige ZK-Abteilung sich dieser Zeitschrift entledigen wollte, weil sie, auf
Berichterstattung aus der Sowjetunion spezialisiert, sich als zu anfällig
erwiesen hatte, gegenüber Gorbatschows Perestroika, da hatten der Widerstand der
Redaktion und die Solidarität vieler anderer Journalisten das Blatt retten
können. Nun aber, da die `Presselandschaft´ der ehemaligen DDR, der `fünf neuen
Bundesländer´, oder, wie der Bundesfinanzminister realitätsgerecht sagt: `des
Beitrittsgebiets´, unter die vier großen westdeutschen Zeitungskonzerne
aufgeteilt ist, weht ein schärferer Wind. Da wird kalkuliert und, wenn nötig,
emotionslos amputiert. Wie auch die Lyrik meines Verlages (Aufbau-Verlag), auf
die er sich bisher viel zugute hielt: Sie rechnet sich nicht und mußte aus dem
Verlagsprogramm gestrichen werden. Mann, sage ich. Das hätte sich aber die
Zensur früher nicht erlauben dürfen! – "Das hätten wir uns von der auch nicht
gefallen lassen", sagt eine Verlagsmitarbeiterin.
Wo sie recht hat, hat sie recht.“

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
„Als Mensch kommt man sich hier, in der
stillen, schneeweißen Wüste, wie ein kleines Sandkorn vor. Wer allerdings
hierher fährt, der kann sich von der Frische der Meereswinde, die aus den
zwei hier zusammenfließenden Ozeanen kommen, bezaubern lassen, die
einzigartige Flora und Fauna der Arktis bestaunen, geheimnisvolle Zeugnisse
und Kultstätten der antiken Tschuktschen entdecken und von einem Kontinent
auf einen anderen hinüberblicken.“
Irina Reschetowa
in: Russland HEUTE vom 19. Mai 2013
Wenn Sie sich die folgenden Texte zu Gemüte
geführt und Lust bekommen haben, die Tschuktschen-Halbinsel zu bereisen und die
Tschuktschen kennenzulernen, sei
Ihnen das Reisebüro
?
empfohlen; denn – so lautet ein tschuktschisches Sprichwort -
Einmal selbst sehen ist mehr wert als hundert Mal davon hören.
(Hier könnte Ihre Anzeige stehen!)
Die
TSCHUKTSCHEN… (Eigenbezeichnung:
Luorawetlan = Wahre Menschen)...
leben vorrangig auf der Tschuktschen-Halbinsel, die sich bis zum äußersten Norden
des russischen Fernen Ostens erstreckt, umspült von den Randmeeren zweier
Ozeane, nur durch die Beringsstraße von Alaska getrennt.
"Nur hier kamen die beiden Großmächte [Amerika
und die Sowjetunion] einander nahe, und nur hier, zwischen den Inseln Großer
und Kleiner Diomid, betrug der Abstand zwischen ihnen ganze vier Kilometer
und hundertvier Meter Wasser."
Juri Rytchëu (tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des
Vergessens, 2007
Zu Tschukotka gehören die Tschuktschen-Halbinsel,
das anliegende Festland etwa bis zum
Fluss Omolon und einige Inseln wie die
Wrangelinsel
(UNESCO Weltnaturerbe), die
Insel Aion, die Ratmanow-Insel.
Wrangelinsel
:
Der vom Bürgerkrieg her unrühmlich bekannte weißgardistische
General
Wrangel hat mit dem Namen dieser Insel nichts zu tun. Die Insel ist nach
dem russischen Seefahrer Ferdinand Wrangel benannt, der zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts als 24jähriger Leutnant von der russischen
Regierung ausgesandt worden war mit dem Auftrag, Gerüchte auf ihren
Wahrheitsgehalt zu überprüfen, die von einem Nordland an der Tschuktschenhalbinsel sprachen. Vier Jahre hintereinander durchquerte
die Wrangel-Expedition das Eis, und viermal kehrte sie ohne Ergebnis
heim. Eisige Fröste und Packeis versperrten Menschen und Hunden den Weg,
trotzdem aber fuhr Leutnant Wrangel nach Petersburg zurück in der festen
Gewissheit, dass jenes Nordland tatsächlich existiere. Anhand
inoffizieller Angaben, von Sagen und Erzählungen der Tschuktschen konnte
er sogar genau voraussagen, wo es sich befand. Erst 1867 sichtete aus
fünfunddreißig Kilometer Entfernung der amerikanische Walfänger Long die
Insel. Ihre Koordinaten stimmten mit den Angaben Wrangels überein, und
so hielt es Long nur für recht und billig, der Insel den Namen Wrangels
zu geben.
Es existieren verschiedene
Versionen über die Herkunft des Namens dieses Volkes, die meine stammt von dem
ersten Schriftsteller der Tschuktschen, von Juri Rytchëu, und bedeutet "wahre
Menschen". Andere Wissenschaftler vermuten, dass das Wort "tschuktschi" eine
Abwandlung des Wortes "tschaitschu" in der russischen Sprache ist, was übersetzt
"reich an Rentieren" bedeutet. Gerade so bezeichnen sich die Rentierzüchter
unter den Tschuktschen, die weit weg vom Meer leben. Dagegen nennen sich die
Tschuktschen in den Küstengebieten "ankaljyn", was buchstäblich "die am Meer
Lebenden" bedeutet. - Von Deutschland aus beträgt die Entfernung bis Tschukotka
dreizehntausend Kilometer, der Zeitunterschied zwischen der Tschuktschen-Halbinsel und Mitteleuropa vierzehn Stunden - das ist der
größte Zeitunterschied zwischen Russland und Deutschland.
„Die Tschuktschen sind ein kräftiges Volk. Sie
sind nicht ohne Kenntnisse und namentlich geschickt in Schnitzereien aus
Walroßbein. Das Tschuktschenland ist das rauheste und unfreundlichste von ganz
Sibirien.“
Brockhaus´ Konservations-Lexikon, F. A.
Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien
1894
Bevölkerung:
Nach der Volkszählung von 1926 zählten die Tschuktschen 12 331 Angehörige; 1939
wurden 13 830 Tschuktschen gezählt; 1959 waren es 11 680 Tschuktschen; 1970 gleich
13 500; 1979 gleich 13 397; 1989 gleich 15 107; 2002 gleich
15 767; nach der letzten Volkszählung von 2010 gaben sich 15 908 Personen als
Tschuktschen aus. Die Ureinwohner Tschukotkas sind seit alters Tschuktschen und asiatische Eskimos; die
Tschuktschen gehören zur Arktis-Rasse der Mongoloiden. Die Tschuktschen- Halbinsel erlebte
eine große Einwanderungswelle, die die Einwohnerzahlen zwischen 1955 und 1975
von 7 000 auf 15 000 hochschnellen ließ. Inzwischen machen die Tschuktschen als
Titularnation nur 25,3 % aus – neben Russen (49,6 %), Ukrainern (5,7 %),
Eskimos (3,0 %) u. a.; dennoch ist Tschuktschisch regionale Amtssprache. Ein
Teil dieses Volkes lebt auch im Autonomen Kreis der Korjaken, ebenso in der
Republik Jakutien. Von 1989 bis 2002 hat Tschukota
wegen des wirtschaftlichen Niedergangs nach dem Zerfall der Sowjetunion etwa
zwei Drittel seiner Einwohner (vor allem Russen, Belorussen, Ukrainer) durch
Abwanderung verloren. - Die Bevölkerungsdichte beträgt 1 Einwohner pro
zehn Quadratkilometer, damit ist der Autonome Kreis der Tschuktschen das am
dünnsten besiedelte Gebiet der Erde.
Fläche:
Die Fläche Tschukotkas beträgt 737 700 Quadratkilometer.
Tschukotka - die Oberfläche ist vorwiegend gebirgig, durchzogen von zahlreichen
Flüssen - liegt liegt im
Ostsibirischen Bergland und umfasst unter anderem den Nordteil des Korjakengebirges, das Anjuisgebirge das Anadyrgebirge bis zur
Tschuktschen-Halbinsel, wo im Kap Deshnjew der östlichste Punkt Russlands bzw.
Asiens liegt. Das Gebiet liegt fast vollständig nördlich der
Baumgrenze und wird von Tundra bedeckt, die in den höheren Bergregionen in
eine Frostschuttwüste übergeht. Lediglich in den südlichsten Gebieten von Tschukotka
findet man in geschützten Lagen niedrig wachsende Bäume.
Geschichtliches:
Die erste schriftliche Erwähnung
Tschukotkas erfolgte durch den Russen Semjon Deshnjew, der 1648 als erster Mensch
die Tschuktschen-Halbinsel umsegelte. Die Kolonisation der tschuktschischen
Gebiete durch die Russen begann im 17. Jahrhundert. Die Tschuktschen leisteten
zunächst heftigen Widerstand. 1730 schlugen sie eine vierhundert Mann starke
russische Truppe, 1747 wiederholte sich dieser Sieg, so dass die Russen ihre
Garnison im Friedensvertrag räumen mussten. Letztlich konnten die Tschuktschen
der Übermacht aber nichts entgegensetzen, und so kamen sie 1789 unter russische Herrschaft.
Die zaristische Verwaltung hatte erhebliche Schwierigkeiten, der Unbotmäßigkeit
der Tschuktschen Herr zu werden. 1822 erfolgte der
Erlass "Über fremdartige und nicht vollkommen abhängige Völkerschaften", worauf
Tschuktschen und asiatische Eskimos keine Steuern zu zahlen brauchten.
"Das riesenhafte
Waldland und die Waldsteppe Sibiriens fielen im 16. Jahrhundert fast
kampflos den Russen in die Hände. Nachdem Kasan, die Tatarenhauptstadt des
Nordens, 1552 gefallen war, zogen kleine Abteilungen von wenigen Hundert
Mann ostwärts und eroberten in sechzig Jahren ein Territorium von 5 000 km
Ausdehnung von West nach Ost. Russen gelangten an die Küste des Pazifik,
bevor sie an die Ostsee und das Schwarze Meer kamen. - Sie ließen die
Usbeken in Mittelasien abseits liegen und trafen erst im Osten auf
mongolischen Widerstand, weshalb sie weiter in den Norden zogen und 1641 das
Ochotskische Meer erreichten. Im Osten hatten nur die Tschuktschen
bewaffneten Widerstand geleistet. Um 1700 waren Sibirien und der Ferne Osten
besetzt."
Burchard Brentjes (deutscher
vorderasiatischer Archäologe, 1929 bis 2012) in: Die Ahnen des Dschingis-Chans,
1988

Dschingis-Chan (Tschingis-Khan,
wahrscheinlich 1155 bis wahrscheinlich 1227) war ein Chan der Mongolen, der die
mongolischen Stämme vereinte und weite Teile Zentralasiens und Nordchinas
eroberte.
Porträt der Yüan-Zeit, 13.
Jahrhundert aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
- 1922 siegte die
Sowjetmacht auf Tschukotka.

Der russische
Polarforscher Iwan Papanin (1894 bis 1986) im Jahre 1938. Er leitete die
Expedition, bei der vermutlich zum ersten Mal Menschen den geographischen
Nordpol betraten.
Foto aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
Staatsgefüge:
Am 10. Dezember 1930 wurde der Nationale Kreis der
Tschuktschen gegründet, der 1977 in Autonomer Kreis der Tschuktschen umbenannt
wurde. Der Autonome Kreis der Tschuktschen ist 1991 aus der Region Magadan
ausgetreten. Heutzutage ist Tschukotka der einzige Autonome Kreis Russlands, der
nicht Bestandteil einer anderen Region ist. - Nach dem Fall der Sowjetunion im
Jahre 1991 erklärte sich der Tschuktschische Autonome Kreis nach
jahrzehntelanger Unterordnung gegenüber dem Gebiet Magadan zu einer unabhängigen
Autonomie innerhalb der Russischen Föderation. 1992 unterzeichnete Tschukotka
einen Vertrag, der den Status eines autonomen Bezirks unabhängig von Magadan
zusagte. Dieses Gesetz sicherte der regionalen Regierung größere Unabhängigkeit
in der Innenpolitik, der Wirtschaft sowie im Ex- und Importgewerbe zu. Dieser
Triumph war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Region bald schon in dasselbe
wirtschaftliche Chaos stürzte, den die übrige Nation schon seit 1991 erlebte.
Verbannungsgebiet: Die russische Besiedelung des Gebietes Magadan,
zu dem Tschukotka bis 1991 gehörte, begann im 17. Jahrhundert. Zu Sowjetzeiten
war die Region als Standort zahlreicher GULAGs berüchtigt. Die Stadt Magadan war
als Transitstadt für die Verschickung von Zwangsarbeitern in die Bergbaugebiete
gegründet worden. Die Transsib transportierte die
Sträflinge bis Wladiwostok, von da an beförderte man die Häftlinge weiter auf
dem Seeweg über das Japanische und das Ochotskische Meer. Sobald die Schiffe
sich Hokkaido näherten, wurden um die menschliche Fracht zu verbergen, die Luken
dichtgemacht, die Lichter gelöscht. Viele Zwangsarbeiter erreichten nie den
Hafen Magadan, weil sie schon vorher verstarben.
„Von
Beginn des 17. Jahrhunderts an lernten die russischen Zaren die Verbannung
als nützliches Herrschaftsinstrument schätzen: Die Monarchen konnten so
missliebige Zeitgenossen loswerden und, genauso wichtig, die gewaltige Weite
Sibiriens besiedeln. - In die Ferne gejagt wurden Räuber und Diebe,
Kriegsgefangene, meuternde Soldaten, Kinderschänder, widerspenstige Bauern,
Menschen mit dem falschen Glauben oder einer störenden politischen
Einstellung. - Später kamen, mehr oder weniger wahllos, Meineidige,
Verleumder und zahllose Männer und Frauen hinzu, die gegen irgendein Verbot
verstoßen hatten, war es auch nur das des Tabakrauchens. Auch wer keine
Steuern zahlte oder als Leibeigener ohne Erlaubnis einen Baum fällte, musste
mit Verbannung rechnen. - Doch nicht nur echte oder angebliche Bösewichte
wurden deportiert, die Zaren schoben auch zahlreiche Menschen nationaler
Minderheiten wie Tataren, Juden oder Kaukasier nach Sibirien ab. -
Russland stand mit dieser
Strafpraxis nicht allein: Großbritannien verschiffte missliebige Untertanen
nach Australien, Frankreich schickte sie in sein Übersee-Departement
Guayana. Bis zu
seinem Ende 1917 wurden im Zarenreich wohl weit über eine Million Menschen
in den weiten und kalten Osten des Reiches vertrieben, exakte Zahlen gibt es
nicht.“
Der Spiegel vom 31.
Januar 2012
- In der Stadt Pewek auf Tschukotka befand sich zu Stalins Zeiten die Verwaltung
mehrerer Straflager im System des Gulag. In diesen Lagern waren zeitweilig bis
zu elftausend Menschen gleichzeitig inhaftiert.
"Laut unserem
Historiker im Museum von Magadan sind insgesamt mindestens 130 000 Häftlinge
umgekommen, 12 000 davon durch Erschießungen. Diese Zahlen sind nicht zu
verwechseln mit jenen, die für den gesamten GULAG der Sowjetunion, also
nicht nur für den Nordosten Russlands gelten."
Thomas Roth in: Russisches
Tagebuch, 2002
Hauptstadt:
1889 als Nowo-Mariinsk
gegründet, nach der Zarin Marija Alexandrowna (Maria von Hessen-Darmstadt)
benannt, der Gattin des Zaren Alexander II. 1923 wurde Nowo-Mariinsk in Anadyr
umbenannt - nach dem gleichnamigen Fluss und erhielt 1965 Stadtrecht.
Tschukotkas Hauptstadt
Anadyr hat 13 045 Einwohner (2010). Anadyr ist eine Hafenstadt, die sich an der Küste
des Beringmeeres an der Mündung das Anadyr befindet, sie hat Verbindung zur Beringstraße.
"In Anadyr wurde in
jenen Jahren wie auf ganz Tschukotka viel getrunken. Vor allem Sprit, der in
großen Mengen in Blechfässern herangeschafft wurde. In einigen Kreisen
versuchte man daraus mehr oder minder edle Getränke herzustellen (...),
meistens trank man den Sprit allerdings einfach mit Wasser verdünnt. Im
Winter galt es als besonders verwegen, einen Schluck reinen Sprit zu trinken
und etwas Schnee dazu zu essen."
Juri Rytchëu (tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des
Vergessens, 2007
- Nach dem beständigen Abwärtstrend der 1990er Jahre entwickelten sich nach der
Jahrtausendwende in Anadyr einige neue Einrichtungen, unter anderem ein Farmbetrieb für
Legehennen, dessen Produktion bei etwa 800 000 Eiern pro Jahr liegt, und das im
Jahre 2001 erschlossene Erdgasfeld am Zapadnoje ozero (Westsee), mit dem Anadyr
durch eine 2002 eröffnete Pipeline verbunden ist. Im selben Jahr wurde das neue
Gebäude des Regionalparlamentes fertig gestellt, das vorhandene "Hotel Tschukotka"
wurde renoviert und ein weiteres in Auftrag gegeben.
Wirtschaft:
Die Tschuktschen unterscheiden sich entsprechend ihrem
Lebensraum in Rentier-Tschuktschen und Küsten-Tschuktschen. Die einen leben in
der Tundra und züchten Rentiere, die anderen wohnen direkt am Meer und sind
Meerestierjäger und Fischer. Seit alters befassen sich die Einwohner der
Tschuktschen-Halbinsel auch mit der Rentierzucht. Schon seit Ende des ersten
Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung begannen die Menschen Rentiere zu zähmen,
was ihnen aber nicht gelang, und so wurde das Ren kein Haustier. Daher muss der
Mensch ihm ständig folgen, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter: bei Sturm und
Schneegestöber und bei mehr als 50 Grad starken Frösten. Das ist eine schwere
Arbeit, bei der früher viele Menschen starben, ganze Familien, manchmal sogar ganze
Niederlassungen. Es kam vor, dass diese oder jene Ortschaft noch auf der
Landkarte eingetragen war, während sie praktisch schon nicht mehr existierte. - Die Wirtschaft
unter der Sowjetmacht beeinflusste sowohl städtische
als auch ländliche Gebiete. Kleinere Städte wuchsen zu Großstädten heran, die
eine abwechslungsreiche Infrastruktur entwickelten. Die Dörfer unterliefen noch
dramatischere Veränderungen, was durch die Einrichtung von
kommerziellen Fuchsfarmern hervorgerufen wurde. Die kleinen einheimischen
Kolchosen der 1940er Jahre wurden in staatseigene Sowchosen umgewandelt.
Im Autonomen Kreis der Tschuktschen wie auch in den
Nachbarregionen prägen der Fischfang und der Goldabbau die Wirtschaft.
In der Gebietshauptstadt gibt es das Fischunternehmen "Rybsawod". Neben den Goldvorkommen finden sich auf Tschukotka
auch Wolfram und Zinn, Erdöl, Naturgas und Kohle. Ein weiterer wichtiger
Wirtschaftszweig ist der Bergbau (Erze, Steinkohle, Gold).
"Wie sich
herausstellte, durfte man aus Gründen der militärischen Geheimhaltung nicht
schreiben, dass auf Tschukotka Gold* gewonnen wird. Das Wort wurde durch den
Ausdruck `wertvolles gelbes Metall´ ersetzt, dessen Bedeutung sogar ein
Vollidiot erraten konnte. Es war nicht erlaubt, über die Waljagd zu
schreiben. Wale wurden im Text zu den `größten Meerestieren´. Wenn ein
besiedelter Punkt erwähnt wurde, durfte man auf gar keinen Fall agen, daß es
dort einen Flugplatz oder einen Ladeplatz gab. Offenbar war das Verzeichnis
der Verbote so groß, daß sich in einem Text ... immer etwas fand, das auf
Verlangen eines rätselhaften ... Menschen aus dem `Städtischen Literaturamt´
geändert werden mußte. (...) Doch den Zensoren war das noch nicht genug. Sie
achteten streng auf die richtige ideologisch-künstlerische Tendenz eines
Werkes. in einer Erzählung mußte der ganze Text umgearbeitet und schließlich
auf ihre Veröffentlichung verzichtet werden, weil darin beschrieben wurde,
wie ein russischer Bursche ein Mädchen betrog, ihr die Heirat versprach,
aber dann wegfuhr und sie mit kleinen Kindern sitzenließ. So etwas war auf
Tschukotka gang und gäbe - für die Zeit eines Vertrages oder einer
Dienstverpflichtung zu heiraten. Doch wie sich herausstellte, war auch das
ein streng gehütetes Staatsgeheimnis."
Juri Rytchëu (tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007
* Ich war 1980 als Journalistin auf Tschukotka und besichtigte sowohl
ein Goldvorkommen und das Kernkraftwerk Bilibino und nahm an einer Waljagd teil,
um darüber zu schreiben.
- Es war der
Tod Joseph Stalins im Jahre 1953, der die sowjetische Wirtschaft und die
politische Strategie neu gestaltete. Neue Bauprogramme wurden erarbeitet, Dörfer
neu organisiert und kleinere Lager und Siedlungen unter einer Politik der
ländlichen Konzentration und Modernisierung gebildet.
- In Bilibino
arbeitet seit ein Kernkraftwerk. Die russische
Behörde für die Umwelt-, Technologie- und Atomaufsicht „Rostechnadsor“ prüfte
2007 das Atomkraftwerk in Bilibino. „Die Experten von „Rostechnadsor“
vergewisserten
sich, dass im Atomkraftwerk Bilibino alle
Maßnahmen der Atom- und Strahlungssicherheit eingehalten werden“, heißt es in
der Pressemitteilung. Das Atomkraftwerk Bilibino liegt über dem Nordpolarkreis
im Osten des Landes und war zwischen 1974 bis 1976 fertig gestellt worden. Es
dient vorrangig der Strom- und Wärmeversorgung der Goldindustrie und der Stadt
Bilibino, wir besuchten es 1980. -
Bei der Lachsproduktion liegt
die
Region an sechster Stelle im Fernen Osten.
Gleiches gilt auch für Krabben, die hier als harte Währung gelten.
- In den Neunziger Jahren war Tschukotka von einer schweren Wirtschaftskrise
betroffen: Von einem Rückgang der Rentierbestände [Als wir Tschukotka bereisten
weidete dort die größte Rentierherde der Welt: über eine dreiviertel Million
Tiere.], und zum Teil erfolgte ein Zusammenbruch von Bergbau und Industrie.
"Laut der
US-Geologiebehörde lagern 13 Prozent der globalen Erdölreserven in der
Arktis."
Claus Hecking in: Die Zeit vom
01.10.2015
Verkehr: Die
meisten Orte auf Tschukotka sind nicht an ein festes Straßennetz angeschlossen,
sondern sind über unbefestigte Pisten erreichbar. Geplant ist eine Straße von
Anadyr nach Omolon mit Abzweig nach Bilibino, wo sich ein Kernkraftwerk
befindet. In Omolon befindet sich ein Flughafen,
über den Verbindung nach Anadyr, Magadan und Bilibino besteht. Ab Omolon ist der
Anadyr schiffbar, in der eisfreien Zeit besteht Schiffsverbindung. Ein weiterer
Flughafen befindet sich in dem Dorf Markowo (2010 hatte Markowo 809 Einwohner),
über den Verbindung in die Hauptstadt Anadyr besteht.
Sprache/Schrift:
Die
tschuktschische Sprache ist eine paläoasiatische Sprache; 1930
entwickelte der russische Wissenschaftler Wladimir Bogoras (1865 bis 1936) für die Tschuktschen ein eigenes
Alphabet, 1932 die erste Fibel, wonach sich alsbald eine reichhaltige Schriftkultur herausbildete,
mit der
vor allem die vielen bisher nur mündlich überlieferten Mythen, Sagen und Märchen
dieses Volkes aufgezeichnet wurden. Als Schrift dienen bis heute
die kyrillischen Buchstaben mit Zusatzzeichen. Der Russe Bogoras war als
Volkstümler (Narodowolze) nach Tschukotka verbannt worden. Später verfasste der
russische Lehrer Pjotr Skorik einige modernisierte Lehrbücher und Grammatiken
für die tschuktschischen Schulen. Auf Tschukotka nennt man ihn achtungsvoll
"murgin", das heißt "unser Lehrer".
Heute wird "alles
in den Schmutz gezogen, was diese (Sowjet-)Generation geschaffen hat. Sie fuhren als
echte Enthusiasten in den Norden, als Pioniere, erfüllt von dem Bewußtsein,
daß es ihre Pflicht sei, den Nordvölkern das Lesen und Schreiben zu
vermitteln. Und nun soll es diese Großtat nicht gegeben haben!"
Juri Rytchëu (tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des
Vergessens, 2007



Drei
Seiten aus einer tschuktschischen Fibel.
Reproduktionen
aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
- Der Russe Wladilen Leontjew wuchs in der
Tschuktschensiedlung Uelen auf, Mitte der dreißiger Jahre kam er dort in die
Schule. Die erste Schrift, die er lernte, war die neue Tschuktschenschrift.
Leontjew wurde später Kandidat der Geschichtswissenschaften und Mitglied des
Schriftstellerverbandes und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Forschungsinstitut von Magadan. Er erzählt von der Schaffung der
tschuktschischen Sprache: "
Wladimir
Bogoras beherrschte die Tschuktschensprache perfekt. Er war als Volkstümler
verhaftet und für zehn Jahre nach Kolyma [zu den Komi] verbannt worden. Als er
von dort flüchtete, gelangte er auf die Tschuktschen-Halbinsel. Seine erste Fibel,
1934 geschaffen, wurde von dem Tschuktschen Wukwol illustriert, der später als
Elfenbeinschnitzer sehr bekannt wurde."
"Der erste
russische Lehrer war Dmitri Korsh. Er wohnte in der Siedlung Sneshny neben
dem Zelt seines Schülers, des Hirten Kentschi. Der Hirt schrieb seinem
Lehrer täglich kleine Briefchen, z. B. folgenden Inhalts: `Schon drei
Rentiere haben gekalbt. Ich habe alle Rentiere in der Herde gezählt.´
Kentschi lief seinen Briefen immer gleich hinterher, um dann mit zufriedenem
Lächeln zuzuschauen, wie Dmitri Korsh seine Briefe las."
Wladilen Leontjew, in den siebziger
Jahren
Zu Beginn des
Jahres 1935 erfolgte der Unterricht in der tschuktschischen Muttersprache
bereits an 29 Schulen. Viele Tschuktschen lernten dann später weiter an der
Pädagogischen Schule der Völker des Nordens in Anadyr und wurden selbst Lehrer.
1937 wurde das tschuktschische Alphabet um neue Schriftzeichen bereichert,
welche für die spezifischen Laute dieser Sprache stehen. Der Verfasser der neuen
Tschuktschenfibel war Innokenti Wdowin, später Doktor der
Geschichtswissenschaften und Autor vieler historischer Beiträge über Tschukotka.
- Tschuktschisch ist heute regionale Amtssprache.
Literatursprache/Literatur:
Seit den 1950er Jahren ist das Tschuktschische
Literatursprache. Bis 1957 wurde die schöngeistige und Unterrichtsliteratur in
der Tschuktschensprache in Leningrad herausgegeben. Der erste Dichter der
Tschuktschen war Viktor Këulkut (1929 bis
1963). Er war der Sohn eines Rentierzüchters und übte selbst den Beruf
eines Zootechnikers aus. 1954 begann er als Redakteur bei der Zeitung „Sowjet-Tschukotka“
zu arbeiten. Im gleichen Jahr wurde sein erstes Werk mit Gedichten
veröffentlicht; sie schildern das Leben und die Arbeit der Rentierzüchter auf
Tschukotka und die malerische Landschaft. Er schrieb auch Gedichte für und über
Kinder. Von Këulkut erschienen noch weitere Gedichtbände, der Band, der 1966
bereits nach Këulkuts Tod erschien, mit
einem Vorwort von Juri Rytchëu.
In den siebziger Jahren
wurde beim Magadaner Buchverlag eine Tschuktschenredaktion gegründet, jetzt
erschienen im Magadaner Buchverlag auch viele Klassiker der russischen
Literatur, z. B. Puschkin, Tolstoi, Gogol in tschuktschischer Sprache. -
Die erste Dichterin der Tschuktschen ist Antonina Kymytwal,
der bekannteste Schriftsteller der Tschuktschen ist Juri Rytchëu (1930
bis 2008). Ich weiß
von Juri Rytchëu selbst, dass er erst 1931 geboren wurde. Zum angeblichen
Geburtsjahr 1930 kam es so: "(...) Doch um angestellt zu werden, brauchte man
einen Pass. Borinda (ein russischer Bekannter Rytchëus, der als Hydrograf
arbeitete) versicherte mir: `Du wirst deinen Ausweis gleich kriegen´, und
schrieb eine Notiz an den Chef der Miliz. Ich wusste, dass ich mindestens
sechzehn Jahre alt sein müsste, um einen Pass zu bekommen, und ich änderte
vorsichtshalber auf meinem einzigen offiziellen Dokument - dem
Komsomolausweis
- das Geburtsjahr 1931 in 1930 um, was keine große Kunst war." So kam der erste
Schriftsteller der Tschuktschen zu seinem Namen Rytchëu:
"Es gibt eine
Familienlegende, die besagt, wie ich den Namen Rytchëu, ´Der Unbekannte´,
erhielt. Angeblich soll mein Großvater, der berühmte Uëlener Schamane Mletkin,
bei meiner Namengebung ein Ritual veranstaltet haben. Im Tschottagin wurde ein
heiliges Feuer entfacht, vom Rauchabzug wurde an einer dünnen Schnur aus
Robbenleder ein heiliger Gegenstand herabgelassen - die Schwebenden Flügel. Ich
kann dieses Ritual nur nach den Worten meiner Mutter beschreiben, da ich damals
zu klein war, um mich zu erinnern. Großvater Mletkin, der sich im Schatten der
Schwebenden Flügel am heiligen Feuer niedergelassen hatte, sprach langsam und
deutlich verschiedene Namen aus, die er für mich ausgewählt hatte. Wenn die
Götter den Namen hörten, der ihnen gefiel, sollten sie durch eine Bewegung der
Schwebenden Flügel ein Zeichen ihrer Zustimmung geben. Großvater zählte die
Namen von nahen und fernen Vorfahren auf, die zu Ruhm gekommen waren, dann
folgten die weniger bekannten Verwandten, aber die Schwebenden Flügel bewegten
sich nicht, sie reagierten nicht auf die Worte des Schamanen... Als mein
Großvater sah, dass er nicht zum Ziel kam, sagte er: `Dann soll er Rytchëu
heißen - Der Unbekannte!´"
Juri Rytchëu (tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Das
Alphabet des Lebens
Bleibt noch zu sagen, wie Rytchëu zu seinem Vor- und
Vatersnamen (Sergejewitsch) kam: Als er seinen Pass beantragte, musste er
- wie es in Russland Sitte ist - Vor- und Vatersname
angeben. "Es war mir aus unerfindlichen Gründen peinlich zuzugeben, dass ich weder Name
noch Vatersname hatte. Am anderen Ufer der Prowidenija-Bucht, auf der
Polarstation, arbeitete ein alter Bekannter aus Uëlen, der
Meteorologe Juri Sergejewitsch. Ich besuchte ihn manchmal, holte mir Rat bei ihm
in allen möglichen Lebensfragen. Auch diesmal ging ich zu ihm hin und stellte
ihm mein Problem mit dem Pass dar. `Wo können wir bloß einen Namen und
Vatersnamen für dich herkriegen?´, zerbrach sich Juri Sergejewitsch den Kopf. Da
kam mir plötzlich eine blendende Idee. `Was ist, wenn ich Ihren Namen und
Vatersnamen nehme?´ Juri Sergejewitsch dachte lange nach, dann lachte er und
sagte: `Warum nicht? eine gute Idee! Mach ich gern für dich! Das ganze hat aber
bestimmt einen Haken. Ich muss Dir wohl eine schriftliche Bestätigung geben.
Wenn du sie brauchst, gebe ich sie dir! Der Mann hatte eine große Seele. Ich war
glücklich.´" Und so kam es, dass einer meiner Lieblingsschriftsteller Juri
Sergejewitsch Rytchëu heißt.
Bildung: In Leningrad wurde in den 1970er Jahren an der
Staatlichen Pädagogischen Alexander Herzen- Universität eine Fakultät für die Völker des hohen Nordens
eingerichtet; die Internatsschüler wurden vollständig vom Staat versorgt. Der
erste Tschuktsche an dieser Hochschule hieß Tewljanto. Ein interessantes
Dokument, das Empfehlungsschreiben des Revolutionskomitees von Anadyr für ist
erhalten geblieben, es lautet: "Der Tschuktsche Tewljanto, der dieses Schreiben
vorzeigt, wird zum Erwerb von Bildung entsandt. Nach seiner Heimkehr soll er
dann die erworbenen Kenntnisse seinen Stammesgenossen mitteilen. Alle, die
dieses Schreiben lesen, werden inständig ersucht, Tewljanto nach Kräften zu
unterstützen. Mit ihrer Fürsorge um das Schicksal dieses Bürgers unterstützen
Sie die ersten Schritt auf dem Gebiet der Bildung der einheimischen Nomaden
unseres hohen Nordens. Das Revolutionskomitee von Anadyr, das sich um das
Schicksal von Tewljanto sorgt, bittet alle Personen, an die er sich mit diesem
Schreiben richtet, ihn nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen und
nötigenfalls an folgende Adresse zu telegraphieren..." Später wurde Tewljanto
Vorsitzender des Exekutivkomitees des Tschuktschen-Kreissowjets der
Werktätigendeputierten und danach erster Deputierter des Kreises der
Tschuktschen im höchsten Machtorgan des Landes, im Obersten Sowjet der UdSSR.
Tewljanto war der erste Tschuktsche, der an der Leningrader pädagogischen
Hochschule studiert hat. Und der heute renommierte Schriftsteller, der
Tschuktsche Juri Rytchëu, erhielt als erster
Angehöriger seines Volkes Universitätsausbildung - an der Leningrader
Universität (siehe Interview weiter unten).
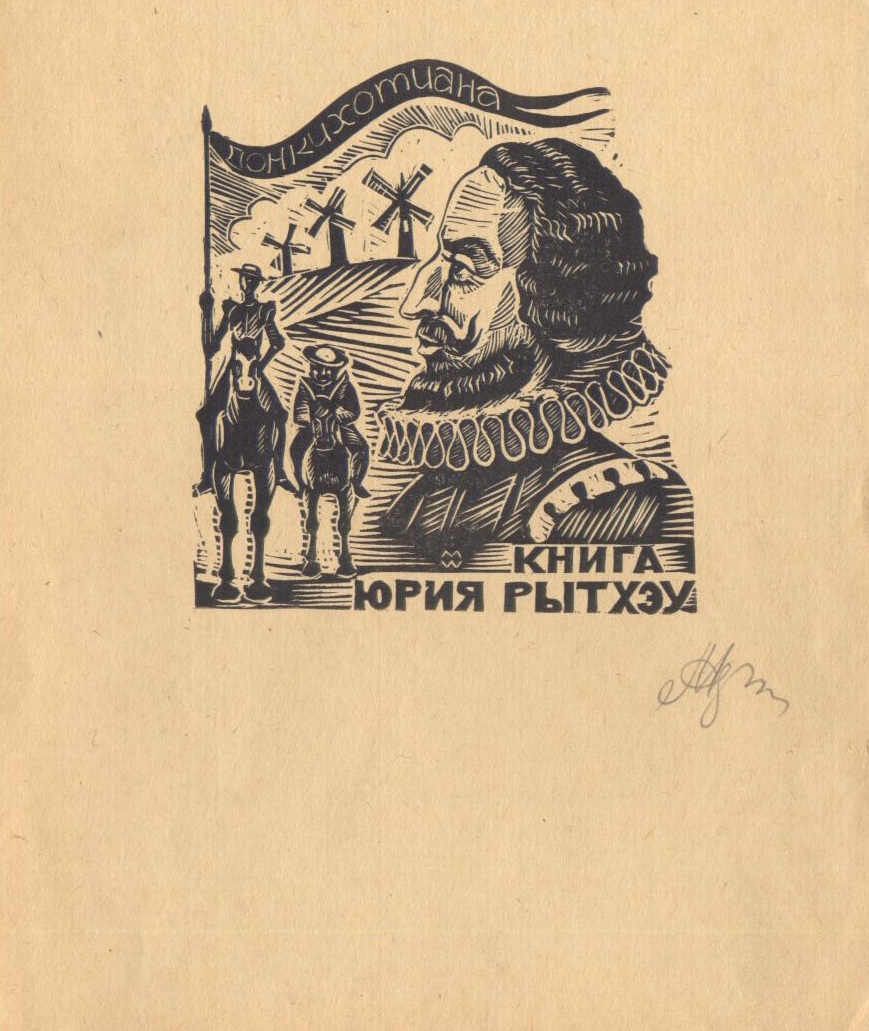
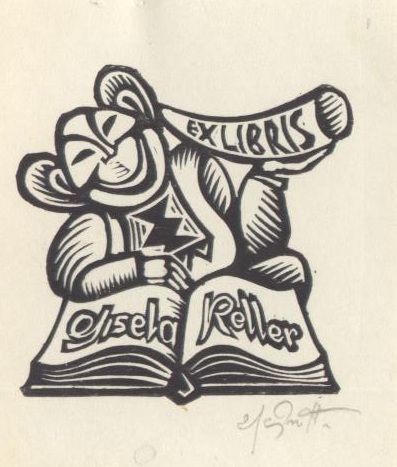
Ex Libris von tschuktschischen Künstlern
angefertigt: für den ersten Schriftsteller der Tschuktschen, Juri Rytchëu,
und für die erste deutsche Journalistin, die zu Sowjetzeiten
nach Tschukotka reiste, Gisela Reller.
"Nach den
Wirbeln die wir seit der sogenannten Perestroika durchgemacht haben, komme
ich immer mehr zu der Einsicht, dass ich mich kaum verändert habe. Wohl aber
habe ich mich von der inneren Zensur befreit, die durch die äußere Zensur
bedingt war. (...) Jetzt kann ich über Themen und Ereignisse
schreiben, über die zu schreiben seinerzeit nicht Brauch war. Und welchen
Sinn hätte es gehabt, für die Schublade zu schreiben!"
Juri Rytchëu(tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008)
in einem Interview mit Leonhard Kossuth im Neuen
Deutschland
vom 15. Dezember 1995
Kultur/Kunst: Weithin anerkannt ist
das traditionelle nationale Kunstgewerbe der Tschuktschen - die Beinschnitzerei,
die Fellgerbung, das Aufbringen von Fellapplikationen, die Stickereien aus
Rentierhaar, die Flechtarbeiten aus den Fasern des arktischen Weidenröschens.
1931 entstand in der Siedlung Uëlen die erste Elfenbeinschnitz-Werkstatt. Die
hier geschaffenen Kunstwerke sind weltbekannt. - Inzwischen gibt es auf
Tschukotka auch einige anerkannte Maler, Zeichner und Illustratoren.



Tschuktschenjunge auf einem Bären;
Wundersame Quelle; Lesender Knabe im Tschuktschenland.
Linolschnitte von Dmitri
Brjuchajow aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Früher schmückten sich die tschuktschischen
Frauen und Mädchen mit Fingerringen, Armreifen, Halsketten, Ohrgehängen aus
Walrosselfenbein.
Gesundheitswesen: Vor etwa einhundert Jahren starb jeder zweite
Tschuktsche und Eskimo
an Tuberkulose. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei etwa 35 Jahren,
die Säuglingssterblichkeit bei 60 Prozent. In den siebziger Jahren stieg die
durchschnittliche Lebenserwartung auf 62 Jahre. Allerdings gab es bei Tschuktschen und Eskimos
inzwischen Krankheiten, die diese Völker früher nicht kannten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Grippe, Masern, Fettsucht... Außerdem machten Tschuktschen und Eskimos durch die Weißen
Bekanntschaft mit dem Alkohol...
"Die Lebenserwartung der Tschuktschen liegt
statistisch bei 43 Jahren. Alkohol, Vitaminmangel und das Zusammenbrechen der
hiesigen Gesundheitsversorgung haben die Ureinwohner regelrecht ruiniert. Ebenso
empörend wie absurd ist unter diesen Umständen, dass der frisch gewählte
Gouverneur Tschukotkas, Roman Abramowitsch, zu den reichsten Männern Russlands
zählt. Natürlich lebt er hauptsächlich in Moskau. Gelegentlich fliegt er mit
seinem Privatjet nach Anadyr, der Hauptstadt Tschukotkas, um sein politisches
Amt auszuüben."
Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2000.
„Ein
betrunkener Ewenke, Burjate, Mongole, Tuwiner, Tschuktsche ist ein besonders
unangenehmer Anblick. Zuerst muss man sagen, dass ihn eine Dosis umhaut,
nach der ein Russe, Pole, ja sogar ein Deutscher seelenruhig Auto fährt - er
aber wälzt sich auf der Straße. Die nordasiatischen Völker vertragen sehr
wenig Alkohol."
Jacek Hugo-Bader
(polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau
nach Wladiwostok, 2014
- In den 50er und 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts fanden auf Tschukotka Atomtests statt. In den 90 Jahren litten fast
90 Prozent der Bevölkerung an Lungenkrankheiten. Nach Angaben des Instituts für
Therapie in der Sibirischen Abteilung der russischen Wissenschaftsakademie für
Medizin ist die Zahl der Hypertoniker (an Bluthochdruck Erkrankter) seit 1959
von praktisch 0 Prozent auf 20 Prozent gestiegen. Und wieder leidet jeder zweite
Tschuktsche und Eskimo an Tuberkulose. Ende der neunziger Jahre war die
durchschnittliche Lebenserwartung auf 45 Jahre gesunken und gehörte zu den
niedrigsten Lebenserwartungen der Welt.
"Die radioaktive
Belastung ist auf Tschukotka doppelt so hoch wie in den übrigen Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion. Die Strahlenbelasung, der die Menschen hier
ausgesetzt sind, ist ebenso hoch wie in den kontrollierten Zonen nach dem
Tschernobyl-Gau."
Progrom Nr. 152/1990
Klima:
Das Klima ist extrem-kontinental auf Tschukotka, der
"Heimat des Winters". Die Jahresdurchschnittstemperaturen
liegen zwischen minus 5 und minus 10 Grad . Der Winter beginnt meist im
September, manchmal schon im August und endet im Mai. Wärmster Monat ist
der Juli mit etwa plus 9 Grad, kältester der Januar mit minus 25 Grad,
Tiefsttemperaturen von unter minus 40 Grad sind möglich. Stürme gibt es zu
jeder Jahreszeit´, sie erreichen oft Orkanstärke. Bei Windböen von 140 bis 150
Kilometer in der Stunde verwandelt sich eine Flagge innerhalb einer Stunde in
Fetzen. In allen Tschuktschen-Siedlungen sind Seile über die Straßen gespannt,
damit die Menschen nicht vom Winde weggefegt werden. Solche
Witterungsverhältnisse herrschen neun Monate im Jahr. – Zweiundvierzig
Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht.
„Gerade im hohen Norden zeigt sich, wie
verheerend die Auswirkungen des Klimawandels sein können. Nördlich des
Polarkreises leben mehr als dreißig [vierzig bis fünfzig] indigene Völker –
viele davon in Sibirien – von der Jagd, der Rentierhaltung, vom Fischfang
und vom Sammeln. ÜberJahrhunderte konnten sie ihre Lebensweise den sich
wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Jetzt droht den rund
vierhunderttausend Ureinwohnern die Vernichtung ihres
arktischen
Lebensraums. Denn hier vollzieht sich der Klimawandel, der in erster Linie
in den Industriestaaten verursacht wird, zwei- bis dreimal schneller als im
globalen Durchschnitt. Höhere Temperaturen lassen das ewige Eis schmelzen
und verändern die Lebensbedingungen für Mensch und Natur. Die Folgen: Die
Ureinwohner müssen zusehen, wie ihre Jagdbeute ausstirbt und wichtige
Pflanzen nicht mehr wachsen. Die schützende Schneedecke schmilzt zu früh, so
dass die Rentiere nur noch verkümmertes Rentiermoos vorfinden. Menschen
sterben, weil vertraute Wege auf dünnerer Eisdecke nicht mehr sicher sind.
Ganze Dörfer mussten schon aufgrund von Küstenerosion und Stürmen
umgesiedelt werden.“
Verein pro Sibiria e. V., München
Das Wort
Arktis
kommt vom griechischen arktikos, in der Nähe des Bären und
bezieht sich auf das Sternbild Großer Bär bzw. Großer Wagen, dessen
beide hinteren Sterne auf den Polarstern weisen. - Die Region Arktis
umfasst Landgebiete von Kanada, Finnland, Grönland, Island, Norwegen,
Russland, Schweden und den USA (Alaska). - Die erste verzeichnete
Expedition erfolgte330 v. Chr. durch den griechischen Seefahrer Pytheas
von Massalia, der ein seltsames Land namens "Thule" vorfand. Zu Hause am
Mittelmeer glaubten nur wenige seine verblüffenden Erzählungen
über leuchtend weiße Landschaften, zugefrorene Meere und merkwürdige
Kreaturen wie große weiße Bären. Pytheas war nur der erste von vielen
Menschen, die im Lauf der Jahrhunderte die Wunder der Arktis beschrieben
haben und den Emotionen erlagen, die sie weckt.
Natur/Umwelt:
Mehr als zur Hälfte liegt die Region Tschukotkas über
dem nördlichen Polarkreis und ist eine Eisbodenzone.
Zu drei Vierteln ist Tschukotka von zum
Teil versumpfter dauerfrostbödiger Tundra bedeckt. - Die
Tschuktschen verwerten von einem erlegten Tier alles, was ihre achtungsvolle
Einstellung zu Natur und Umwelt beweist. Im
gesamten Gebiet der früheren UdSSR wurden bis 1989 einhundertfünfzehn
unterirdische Atomversuche dicht unter der Erdoberfläche durchgeführt. Es
bestanden achtundzwanzig Testgebiete westlich und vierundzwanzig östlich des
Urals, also in Sibirien. Etwa zweihundert Kilometer von Irkutsk, nordwestlich
des Baikals liegen zwei dieser Testgebiete und eines liegt südöstlich des Sees,
etwa vierhundert Kilometer von Irkutsk. Im Westen Sibiriens waren besonders die
Enzen, Nenzen, Selkupen und Nganassanen von den Atomtests betroffen, im Osten
die Chanten und Mansen, im Nordosten die Dolganen, Ewenken und Burjaten und im
Nordosten die Tschuktschen und Jakuten. Zwischen 1950 und 1960 wurden auf
Tschukotka mehrere geheime unterirdische Atomtests durchgeführt, welche laut
einer Moskauer Studie verantwortlich dafür sind, dass rund 90 Prozent der
Tschuktschen an Lungenerkrankungen leiden, und in dem Gebiet die weltweit
höchste Todesrate durch Krebs besteht.
"Das Verhältnis
der Tschuktschen, Eskimos und anderer alteingesessener Bewohner des Hohen
Nordens zu ihren `Ernährern´, den Walrossen, könnte als Beispiel dienen für
maßvolle, sorgsame Nutzung tierischer Ressouroen. Hier sei nur ein Beispiel
gennant: Zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die Zahl der Walrosse auf dem
Liegeplatz Intschoun (Tschuktschen-Halbinsel) deutlich zurückging, trafen
die dort lebenden Tschuktschen in Eigeninitiative Maßnahmen zum Schutz der
Tiere und stellten dazu eigens Wachen auf. Die Wächter achteten darauf, daß
die riesigen Tiere besonders in den ersten Tagen ihren Auftauchens am Ufer
nicht beunruhigt wurden, daß solange der Liegeplatz bestand, in der Nähe
keine Lagerfeuer entfacht wurden, daß die Jäger hier nicht mehr Tiere
erlegten, als , als tatsächlich für das Leben der Menschen notwendig war,
woblei für die Jagd nur Speere benutzt werden durften. Wer die Ordnung
störte, dem drohte harte Bestrafung. Diese einfachen Maßnahmen erwiesen sich
als sehr wirksam, und der Liegeplatz vergrößerte sich von Jahr zu Jahr."
Sawwa Uspenski in:
Tiere in Eis und Schnee, 1983
Pflanzen- und Tierwelt:
Wenn der ewige Frostboden im Sommer einige
Zentimeter auftaut, bringt er die farbenprächtigsten Blumen hervor. In der
Illustrierten FREIE WELT veröffentlichte ich nach unserer Tschukotka-Reise
eine Rücktitelserie "Auf Eis Erblühtes". Rosa Weideröschen blühen, gelbes
Flohkraut, weißes Wollgras... und: es wachsen knöchelhohe Zwergbirken. Lediglich
in den südlichsten Gebieten Tschukotkas findet man in geschützten Lagen niedrig
wachsende Bäume.
"Da mischen sich die
Formen der steinigen oder Flechtentundra mit denen der Moostundra, aber auch
zahlreiche neue treten hinzu und bilden einen bunten Blumenteppich, wie wir
ihn in unseren Alpen gewohnt sind. Und in besonders geschützten
Talschluchten, oft nur wenige Schritte von mächtigen, den Sommer
überdauernden Schneelagern entfernt, begegnet man einer so üppigen
Entfaltung der Flor, wie man sie in diesem Land kaum für möglich gehalten
hätte."
Aurel (deutscher Naturforscher und
Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher
und
Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und
zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882
Zitat:
"Dass das Eis zurückgeht, ist keine Frage -
Satellitenaufnahmen der letzten zehn Jahre zeigen deutlich, dass die
Eisfläche geschrumpft ist -, allerdings it man sich uneinig über die
Ursache. Die meisten Wissenschaftler sind überzeugt, dass der Mensch
verantwortlich ist, nicht einfach natürliche Klimazyklen, und dass die
künftige Ausbeutung dessen, was dort gefunden wird, diesen Prozess
beschleunigen wird. - Am Beringmeer und an der Tschuktschensee mussten
bereits Dörfer umgesiedelt werden, weil die Küste erodiert ist und
Jagdgründe verloren gegangen sind. Eine biologische Umschichtung ist im
Gange. Eisbären und
Polarfüchse müssen wandern, Walrosse
konkurrieren miteinander um Raum und Fische
ziehen nordwärts über die unsichtbaren Grenzen hinweg und erschöpfen die
Bestände der einen Länder und vergrößern jene der anderen. Makrele und
Kabeljau werden jetzt in den Netzen von Arktis-Trawlern gefunden."
Tim Marshall in:
Die Macht der Geographie, Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären
lässt, 2015
- In den beiden Ozeanen wimmelt es von
Fischen. Auch Walrosse, Robben, Seebären und Wale fühlen sich hier wohl.
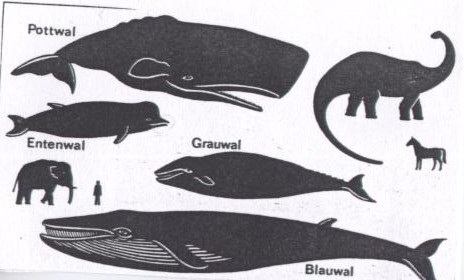
Zum Größenverhältnis von Wal,
Elefant und Pferd...
Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
In der Tundra weiden riesige Herden von
Rentieren.
"Das Bemerkenswerteste am Ren aber ist
wohl seine Fähigkeit, Kälte gut zu ertragen, sich sein Futter unter tiefem
und hartem Schnee hervorzuholen und sowohl beim Laufen über den Schnee als
auch über Morast und Sümpfe nicht einzusinken. Kurz, wenn man sich hier
eines Ausdrucks aus der Technik bedienen wollte, könnte man das Ren als
`Hirsch in Arktisausführung´
bezeichnen."
Sawwa Uspenskiin: Tiere in Eis und Schnee, 1983
Und nie verstummt
der Lärm großer Vogelkolonien in den Küstenfelsen. - Nach Beute suchen Eisbären
und Polarfüchse.

Der Eisbär bewohnt die nördlichen
Polarregionen und gilt als das größte an Land lebende Raubtier der Erde.
Zeichnung von R. Zieger aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
"Die alteingsessenen
Bewohner des Nordens bringen dem
Eisbären Achtung, ja sogar Ehrerbietung
entgegen. Nicht zufällig ist der Eisbär die immer wiederkehrende Hauptfigur
in Märchen, Überlieferungen und Liedern der Völker des Hohen Nordens. Nicht
selten verlieh man ihm auch phantastische Züge. In den Sagen der
Tschuktschen beispielsweise figuriert Kotschatko - ein Eisbär mit einem
knöchernen Rumpf und sechs Tatzen."
Sawwa Uspenski in:
Tiere in Eis und Schnee, 1983
2011 tötete auf der Tschuktschenhalbinsel ein
Eisbär
einen Menschen; Andrej Boltunow, der Vorsitzende des Ausschusses für
Meeressäuger, informierte darüber, dass in der Tschukotka-Region die Polizei,
nachdem sie die Leiche des Mannes gefunden hatte, einen dreijährigen Eisbären,
sowie eine Eisbärin und ihr achtzehn Monate altes Jungtier erschießen mussten. -
Der Gouverneur der
autonomen Region Tschukotka
unterzeichnete 2011 ein Dekret, das den indigenen Völkern – Tschuktschen und
asiatischen Eskimos - die Tötung von 29 Eisbären im Jahr erlaubt. Die Quote geht
auf die Entscheidung einer US-russischen Kommission zurück, die beschlossen
hatte, dass die indigenen Völker Alaskas gemeinsam 58 Eisbären erlegen dürfen.
Während in Alaska
schon zuvor die Jagd erlaubt war, durften auf Tschukotka, das
den Eisbären im Wappen trägt, die Raubtiere seit 1957 nicht getötet werden.
Behausungen:
Die Wohnstätte der mit den Rentierherden
umherziehenden Tschuktschen ist die Jaranga. Ihr unterer Teil ist zylinderförmig
und geht oben in einen Kegel über. Die Wände bestehen aus Stangen, die mit
Robben oder Bärenfellen bespannt werden. In der Mitte der Jaranga befindet sich
die Feuerstelle. Das Innere einer Jaranga gliedert sich in den Tschottagin und
den Polog. Polog heißt der im Inneren der Jaranga durch Tranlampen erleuchtete
und beheizte Schlafraum, aber auch der Fellvorhang, der ihn vom Tschottagin
trennt; ein Holzbalken an seinem Kopfende dient - gegebenenfalls mit Fellauflage
- als Kopfstütze, am Tag vom Tschottagin aus auch als Sitzgelegenheit. Der
Tschottagin ist der den Polog umgebende unbeheizte Innenraum der Jaranga, auch
"kalter Raum" genannt; dient als Aufenthaltsraum, insbesondere bei der
Verrichtung häuslicher Arbeiten; auf offenem Feuer wird hier gekocht. In der
kalten Jahreszeit werden auch die Schlittenhunde im Tschottagin gehalten.

Eine Jaranga: noch heute die Wohnstätte
der nomadisierenden Rentier-Tschuktschen.
Foto: Detlev Steinberg
"Früher war die
Jaranga ein winziges Eiland menschlicher Wärme inmitten der Schneewüste. Sie
ist sehr einfach und zweckdienlich gebaut. Hier ist es warm und gemütlich.
Dem Gast wird starker Tee und auf einer Holzschale duftendes, dampfendes
Rentierfleisch vorgesetzt. Eine Aufforderung zum Zulangen erwartet man
vergebens. Die Tschuktschen machen nicht viele Worte. Wer Hunger hat, greife
zu, wer Tee möchte, halte den Becher hin."
Sputnik Nr. 10/1983
Die ansässig gewordenen Tschuktschen leben heute in
gewöhnlichen Häusern.
Ernährung: Küsten-Tschuktschen und Eskimos waren die ersten
Walfänger der Welt. Heute ist ihre nationale Küche noch undenkbar ohne
Walfleisch - und Rentierfleisch Doch die Jugend bevorzugt schon Eier in Mayonnaise und
Spiegeleier...
"Frauen und Kinder
sahen wir, wenn es das Wetter irgend gestattete, auf die benachbarten
Bergwiesen wandern, um hier Blätter und Wurzeln verschiedener Pflanzen
einzusammeln, teils für den augenblicklichen Bedarf, teils auch als
Nahrungsvorrat für den Winter. Sie werden mit Seehundstran roh gegessen oder
mit Wasser zu einem spinatähnlichen Brei gekocht, und wie wir selbst erprobt
haben, ist das Gericht gar nicht von so üblem Geschmack."
Aurel (deutscher Naturforscher und
Ethnologe, 1848 bis 1908) und
Arthur Krause (deutscher Naturforscher
und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel
und
zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882
Kleidung:
Faszinierend ist die Nationalkleidung der Tschuktschen aus Rentier- und
Robbenfell. Besonders schön ist die bestickte Kleidung der Frauen. Eine Kamlejka
ist ein Umhang aus Stoff mit Kapuze und Bauchtasche, den man über die Kuchljanka
zieht, um deren Fell vor Schnee und Feuchtigkeit zu schützen. Die Kuchljanka ist
ein knielanges Kleidungsstück aus Fell mit Kapuze. Kuchljankas wie auch andere
Kleidungsstücke für Frauen unterscheiden sich von denen der Männer durch
verschiedene Verzierungen, und statt der gesonderten Fellhose der Männer tragen
die Frauen zur Kuchljanka eine Kombination mit großem Brustausschnitt, um beim
Arbeiten den ganzen Arm frei machen zu können. - Der Kherker ist eine sehr weite
Kombination aus Fellen (Hose und Oberteil zusammengenäht) mit sehr breitem
pelzbesetzten Kragen; eine typische Frauenkleidung.

Ob Mann, ob Frau, ob Kind - sie alle tragen im
Winter Kleidung gleichen Schnitts: die "Kuchljanka", eine Kombination aus
Rentierfell, geschmückt mit Lederapplikationen und
Perlenstickerei; die Ornamente symbolisieren fast immer die Sonne. von alters
her tauschen Rentier-Tschuktschen und Küsten-Tschuktschen ihre Produkte aus. Und
so tragen auch die Rentier-Tschuktschen Stiefel aus Robbenfell, "Torbasen"
genannt. Am unwirtlichen Rande der Welt ist nicht so sehr Schönheit
das A und O, sondern Kleidung, die wärmt und vor den eisigen Schneestürmen
schützt.
Deshalb meinen die Tschuktschen sprichwörtlich: Wer ganze Hosen hat,
kann sich setzen, wohin er will.
Zeichnung: Gisela Röder in der
Illustrierten "FÜR DICH" 2/1983; Rücktitelserie "Trachten der Völker der
Sowjetunion" von "Gast"redakteurin Gisela Reller

Winterkleidung für ganz kleine
Tschuktschen: Zum besseren Kälteschutz wurde weiches Rentierfell zu einem
"totalen Overall" verarbeitet
- mit "Schuhen", "Handschuhen", Mütze.
Die Mütze hat (weiter hinten) "Ohren"zipfel als Dekor, die zugleich als Amulett
fungierten. Die weiße Fellklappe kann als zusätzlicher Gesichtsschutz
kochgeklappt werden. Ferner gehört zu einersolchen Säuglingskleidung eine
"Windelklappe"; die Funktion der Windeln erfüllte
weiches, trockenes Tundramoos, das mehrmals am Tag gewechselt wurde.
Foto aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
Aus
der Illustrierten „FÜR
DICH“ 2/1983:
Rücktitelserie "Trachten der Völker der Sowjetunion":
Die
TSCHUKTSCHEN
"Auf
Tschukotka sind 60 Grad minus keine Seltenheit, und
zweiundvierzig Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht. Von
alters her tauschen Rentier-Tschuktschen und
Küsten-Tschuktschen ihre Produkte miteinander aus, so dass
die meisten Tschuktschen eine Kuchljanka aus
Rentierfell und Torbasen (Stiefel) aus Robbenfell tragen. Autor der
Rücktitelserie in der Zeitung „Für Dich“ war Gisela Reller;
Gisela Röder zeichnete die Trachten nach den Angaben und Vorlagen von Gisela
Reller; unverkennbar der sechseckige Eskimoball in den
Händen des Kindes, der einen Ehrenplatz in meiner Wohnung hat."
"Zum ersten mal
sahen wir die Eingeborenen in ihrer eigentümlichen, aus Robben- und
Rentierfellen nicht ohne Geschmack gefertigten Pelzkleidung, über welche sie
meist noch den für alle Polarvölker charakteristischen Überwurf aus
Seehundsdärmen gezogen hatten. (...) Nach eingenommener Mahlzeit brachten
sie einige Handelswaren vor, zumal aus Seehundsfell gefertigte Stiefel mit
zugehörigen Lederstrümpfen und Handschuhen. Nach schlauer Händlerweise
zeigten sie nicht gleich den ganzen Vorrat auf einmal, sondern Stück für
Stück, um die Preise möglichst in die Höhe zu schrauben. Wie wir später
belehrt worden sind, ist die Fußbekleidung der Eingeborenen eine sehr
praktische. Sie ist außerordentlich leicht, hält den Fuß bei feuchtem und
kaltem Wetter warm und trocken, und bei einiger Pflege und Schonung ist sie
ziemlich dauerhaft. (...) Freilich hatten wir es versäumt, zwischen die
Lederstrümpfe und Stiefel nach Weise der Eingeborenen trockenes Gras und
Heide zu stopfen; dadurch wird der Fuß nicht nur bedeutend wärmer gehalten,
sondern auch besser gegen Druck und Stoß geschützt."
Aurel (deutscher Naturforscher und
Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher
und Entdeckungsreisender,
1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882
Folklore:
Weltbekannt
ist das traditionelle Kustgewerbe der Tschuktschen - die Beinschnitzerei, die
Fellgerbung, das Aufbringen von Fellapplikationen, die Stickerei aus
Rentierhaar, die Flechtarbeiten aus den Fasern des arktischen Weidenröschens.
Die Folklore der Tschuktschen ist mannigfaltig, sie hat gemeinsame Züge mit der
Folklore der Korjaken, der Eskimos und der nordamerikanischen Indianer. -
"Alltägliche tschuktschische Lieder glänzen nicht durch viele Worte."
Juri
Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Die Reise der Anna Odinzowa,
2000
Feste/Bräuche: Die
Tschuktschen feiern seit Urzeiten das Fest des Eisbären, des Schutzheiligen der
Meerestierjäger. In alten Zeiten leiteten die Jäger, in Eisbärfelle gehüllt,
mit Tänzen, die die Bewegungen des Eisbären nachahmten, die Jagdsaison ein. Der
Eisbärenkult ist der älteste Kult der Tschuktschen und hat sich bis auf den
heutigen Tag erhalten. Zum Eisbärenfest, das in den Küstensiedlungen gefeiert
wird reisen viele Gäste an: Rentierzüchter aus der Tundra, Mitglieder von
Jagdgenossenschaften, Pelztierzüchter... Der beste Jäger muss einen "Esbären"
mitbringen, den der angesehenste Einwohner der Siedlung darstellen muss. Es wird
getanzt, gesungen, es werden Märchen erzählt. Und beim Essen und Trinken
verraten die Jäger dem Eisbären ihre Sorgen und Probleme. -Unter den tschuktschischen
Frauen und Mädchen waren Tätowierungen sehr verbreitet. - Eine Witwe, schon gar
wenn sie Kinder hatte, ging nach dem Tod ihres Mannes fast immer auf den
Schwager über.
"Im Auftrag der `Magadanskaja
Prawda´ war ich Anfang der sechziger Jahre in der Tschuktschen-Siedlung
Lorino, interviewte einen jungen Jäger und fragte ihn auch nach seinen
Familienverhältnissen. `Ich kann zur Zeit nicht heiraten´, berichtete er mir
treuherzig, `denn mein älterer Bruder ist zur Armee gegangen, und so lange
er dient, muss ich mich um seine Frau und seine Kinder kümmern.´ Ich wollte
wissen, was konkret zu seinen Aufgaben gehört, und er antwortete offen:
`Auch das.´"
Juri Rytchëu im Neuen
Deutschland vom 10/11. April 1999
Ein
alt-tschuktschischer Brauch war, das einem Gast angeboten wurde, mit der Frau
des Gastgebers schlafen. - Nicht ungewöhnlich war auch der Brauch, die Ehefrauen
zu tauschen. - Die Eltern "verheirateten" ihre noch nicht geborenen Mädchen - um
gleich für einen Ernährer zu sorgen. - Alte und unheilbar Kranke wurden getötet
- meist auf eigenen Wunsch. Alten Menschen, die unnütze Esser geworden waren,
wurde somit geholfen "durch die Wolken zu gehen" und keiner fand dabei etwas
Verwerfliches. Schließlich ging es ihnen "in den Wolken" gut...
"Die
Tschuktschen wünschen nicht eines natürlichen Todes zu sterben, weil sie diesen
Tod für schimpflich halten. Greise, welche des Lebens überdrüssig sind, und
welcher ihrer Familie nicht zur Last sein wollen, und auch Junge, die unheilbar
krank sind lassen sich töten, und
man tötet sie ohne Zögern! Das Töten muss einer der nächsten Anverwandten
übernehmen (...) Jeder Tschuktsche hat eine besondere
Kleidung, welche zeitig für den Fall eines freiwilligen Todes hergerichtet wird.
Vor dem Sterben ist der Tschuktsche in der besten Gemütsverfassung; er ist
fröhlich und drückt seine Freude jedem aus, der sich bei ihm verabschiedet. Die
ihn Besuchenden bítten ihn, ihre Freunde und Verwandten, welche er in der
anderen Welt treffen soll, zu grüßen. Der zum Tode bestimmte Tag ist ein
Festtag für die ganze Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte, alle
verweilen vom frühen Morgen in der Nähe des Zeltes, wo sich der
Todeskandidat aufhält. Er erwartet mit Ungeduld im Zelt denjenigen, welcher
ihn töten soll. Während Frauen und Kinder gleichgiltig außerhalb des Zeltes
das Ende des Familienvaters abwarten. Sobald der entscheidende Moment
eintritt, wird alles still in dem bisher lärmenden Haufen. Der im Zelte
befindliche Tschuktsche entledigt sich nun seines Obergewandes, setzt sich
aufs Lager und drückt sich mit seiner linken entblößten Seite dicht an die
Wand des Zeltes. Der Todesvollstrecker durchbohrt mittelst einer Lanze die
Wand und richtet die Spitze der Lanze auf das Opfer, welche dieselbe so
anfügt, daß sie die Rippenbogen trifft. Dann ruft er mit lauter Stimme:
akalpe-kalschelmagdle ( d. h. töte schnell!). Der draußen stehende Mann
schlägt mit voller Kraft der Hand auf das Ende des hölzernen Lanzenstils und
die Lanze durchbohrt quer die Brusthöhle, um auf der anderen Seite blutig
herauszukommen. Im Zelte ertönt nun ein durchdringender Schrei; der
Außenstehende zieht mit einem Ruck die Lanze heraus. Der Tschuktsche ist
infolge des heftigen Stoßes mit dem Gesicht auf den Boden gefallen und die
Eintretenden finden ihn bereits ohne Lebenszeichen. Frauen und Kinder sehen
ruhig und leidenschaftslos auf den entseelten Leichnam des Gatten und
Vaters, in welchem sie auf immer ihren einstigen Beschützer verloren haben.
Man trägt die Leiche aus dem Zelt und führt sie einige Werst weit auf einen
hohen Berg. Zwei Renntiere werden an die Narte (Schlitten) gespannt, zwei
andere werden hinterdrein geführt; alle vier werden dann am Ort des
Begräbnisses geschlachtet. Hatte der Verstorbene eine Rentierherde, so wird
auch diese nachgetrieben. An Ort und Stelle wird eine länglich viereckige
Grube gemacht, die Leiche hineingelegt und ein Fell darauf gedeckt. Darauf
werden die getöteten Renntiere so niedergelegt, daß an jeder Seite der Grube
ein Tier liegt. Damit ist die Zeremonie vorüber und sowohl die Leiche, als
die getöteten Renntiere bleiben den wilden Tieren zur Speise. Alle bei der
Bestattung Anwesenden bleiben bis zum Abend am Grabe."
A. W. Grube Hrsg.), Geographische
Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu
einer
bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891
*
Unsere Frage, ob altersschwache
Leute von ihren Angehörigen getötet würden, wurde verneint. Doch haben
wir später vernommen, daß dieser Brauch noch immer geübt wird, wenn auch
vielleicht nicht in demselben Maße wie in früherer Zeit. Für den Glauben
an eine Art Fortleben nach dem Tod scheinen die Beigaben auf den
Begräbnisplätzen zu sprechen."
Aurel (deutscher Naturforscher und
Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher
Naturforscher und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern,
1881/1882
Religion:
Die
Tschuktschen sind ihrer Religion nach schamanische Animisten. Das Christentum –
von russischen Missionaren nach Tschokotka gebracht - hat in diesem Volk nicht
Fuß gefasst.
"Die Tschuktschen verehren bloß die Sonne; sie
beten niemals und erfüllen keinerlei religiöse Gebräuche, wofern man nicht die
Begräbnisfeierlichkeiten dazu rechnen will. Sie glauben an ein Fortleben nach
dem Tode und geben deshalb dem Verstorbenen einige Renntiere mit auf den Weg.
Die Körper ihrer Toten verbrennen sie oder sie bringen sie auf irgend einen
entfernten Berg, damit sie hier eine Beute der wilden Tiere, besonders der
Wölfe, werden, vor welchen die Tschuktschen eine besondere Achtung haben.
Verbrannt wird die Leiche nur, wenn es der Wunsch des Sterbenden gewesen
war."
A. W. Grube Hrsg.), Geographische
Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu
einer
bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891
Die
Tschuktschen glaubten stets an Geister, sie verehrten Tiere - besonders den
Eisbären, den Wal und das Walross. Der russische Revolutionär, Dichter und
Völkerkundler Wladimir Bogoros (1865 bis 1936) nennt noch Vögel,
Riesen und Zwerge, Hausgeräte und Steine... Der Schamanismus war stark
entwickelt. Die Schamanen imitierten Tierstimmen, ihre Handlungen begleiteten
Klänge des Tamburins, Gesang oder Rezitationen sowie Tänze. Besonders verehrt
wurden Schamanen, die Frauen darstellen konnten oder umgekehrt. Ein Schamane der
Tschuktschen besaß kein spezielles Kostüm, in dem er seine Handlungen ausführte.
- Der letzte Schamane ist Mletkin, der Großvater des tschuktschischen
Schriftstellers Juri Rytchëu (1930 bis 2008).
Begegnet ist er uns schon als Kagot in "Die
Suche nach der letzten Zahl", als Rinto in
"Die
Reise der Anna Odinzowa", als Mletkyn in "Im Spiegel des Vergessens". Nun hat der berühmte Autor dem Großen Schamanen von Uëlen
ein ganzes Buch gewidmet. Zu Sowjetzeiten, als die Schamanen getötet und verbannt wurden, wäre ein solches Unterfangen
unmöglich gewesen. Zu Sowjetzeiten verboten und mit dem Tode bedroht, erleben die Schamanen heute eine Renaissance; im Jahre 2001
fand in Sibirien erstmals ein internationales Schamanentreffen statt, zu dem
vierhundert Schamanen, sogar aus Afrika und Lateinamerika, anreisten.
Ereignisse nach dem Zerfall der
Sowjetunion, sofern sie nicht bereits oben aufgeführt sind:
Im Kernkraftwerk Bilibino im Nordosten Sibiriens, seit 1974 in Betrieb,
ereignete sich am 10. Juli 1991 der bisher schwerste Störfall. Es handelte sich
dabei um einen ernsten Störfall der INES-Stufe 3. Ein weiterer Störfall der
INES-Stufe 2 wurde 1998 bekannt. In den letzten Jahren hat das Kernkraftwerk
durchschnittlich 132 Millionen Kilowattstunden in das öffentliche Stromnetz des
Gebietes Magadan eingespeist. Darüber hinaus wird Wärme an die Stadt Bilibino
abgegeben. Das Kernkraftwerk wurde als erstes und einziges im Nordpolarkreis in
einem Gebiet mit Dauerfrostboden errichtet, um Energie für die Ausbeutung der
Goldminen in der Umgebung bereitzustellen. Eigentümer und Betreiber des
Kernkraftwerkes ist das russische staatliche Unternehmen Rosenergoatom. Die
Reaktoren waren für eine Betriebsdauer von dreißig Jahren vorgesehen. Die ersten
Blöcke haben inzwischen diese Laufzeit erreicht und sollten eigentlich
abgeschaltet werden. Für den Block 1 wurde im Jahr 2004, für den Block 2 im Jahr
2005, eine Laufzeitverlängerung von fünf Jahren genehmigt. Auch für die
Reaktorblöcke 3 und 4 soll eine längere Betriebsdauer erlaubt werden als
ursprünglich geplant. Durch Modernisierungsmaßnahmen soll die Betriebsdauer des
Kernkraftwerks um bis zu 15 Jahre verlängert werden. Ein Ersatz der vier
Reaktoren ist bis 2020 geplant. Mit einer installierten Gesamtleistung von 48 MW
ist das Kernkraftwerk das kleinste in Betrieb befindliche Kernkraftwerk in
Russland und auch weltweit. - Zu den gefährlichsten Nachwirkungen der Sowjetzeit in
Sibirien gehören die Folgen der Atomtests, besonders in der Umgebung von Nowaja
Semlja (die Inseln Kolguew und Wajgatsch) und auf Tschukotka. Die Bevölkerung
wurde nicht weit genug evakuiert, und ein großer Teil der Menschen leidet noch
heute an Strahlenerkrankungen und deren Folgen. - Im Jahre 2000 gewann der
russische Finanzmagnat Roman Abramowitsch (geboren 1966) die Wahl zum Gouverneur
mit 92 Prozent der Stimmen. 2003
kaufte er für 210 Millionen Euro den englischen
Fußballverein Chelsea.
"Zar von Tschukotka im
Kaufrausch: Abramowitsch ist einer der Big-Bosse von `Sibneft´. Die
Gesellschaft holt (auch) aus Tschukotka heraus, was der Boden hergibt. Vor
allem Gaws und Öl. `Sibneft´ verfügt nach der im April vollzigenen Ehe mit
`Yukos´ über Öl- und Gasreserven von etwa 19,4 Milliarden Barrel (1 Barrel
sind knapp 159 Liter) und will täglich 2,3 Millionen Barrel Rohöl fördern.
Dies entspricht etwa der gesamten Produktionsmenge des OPEC-Mitglieds Kuwait
und rund 29 Prozent der russischen Förderung."
Neues Deutschland vom 3. Juli 2003
Aber er ließ auch selbstfinanzierte Lebensmittel und
Fertighäuser aus
Kanada und Treibstoff in den Autonomen
Bezirk verschiffen. Während sich Abramowitsch bei der einheimischen Bevölkerung
aufgrund dieser Maßnahmen hoher Beliebtheit erfreute, sicherte sein Amt dem in
London lebenden
Oligarchen den Schutz vor
Strafverfolgung (politische
Immunität). In neuen russischen Presseberichten über den reichsten
Mann des Landes heißt es aber auch vielfach, dass der damalige Präsident
Wladimir Putin ihn gebeten habe, sich auf
diese Weise um die ihrem Schicksal überlassene Region zu kümmern. Allein die
jährlich entrichteten Steuern von Abramowitsch würden den Regionalhaushalt um
ein Vielfaches übersteigen. 2005 wird der russische Multimilliardär Abramowitsch
im Amt bestätigt. Er habe es verstanden, Tschukotka als Steuerparadies zu
nutzen, sagte der Politologe Stanislaw Belkowskij WELT ONLINE. "Ein Teil der
Mittel verwandte er für die Entwicklung Tschukotkas, der andere floss in seine
eigenen Taschen." Eine Milliarde Dollar soll er als Gouverneur für Tschukotka
aufgewendet haben, berichten russische Medien. Im
Laufe der Wahlkampagne um den Gouverneurssitz mussten Abramowitsch und seine
PR-Leute hart arbeiten, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der
Oligarch keine eigennützigen Ziele auf Tschukotka verfolgt. `Glauben Sie an die
Legende vom Milliardär, der plötzlich auf die dreißig Silberlinge verzichtet?´
fragte die "Moskauer Deutsche Zeitung" vom 23.01.2001. Und weiter? "Nach
Gussinskij und Beresowskij, deren Schicksal
klar ist, ist nun Roman Abramowitsch dran. Ich kann mir folgendes Gespräch im
Kreml vorstellen: Unter Jelzin hat man dich Öl- und Aluminium-Milliardär werden
lassen. Nun musst du dein Geld zum Wohle Russlands verwenden. Hier hast du eine
hoffnungslos zurückgebliebene Region zum Aufpäppeln. Abramowitschs Entsendung
auf die Tschuktschen-Halbinsel kann als eine ehrenvolle Verbannung betrachtet
werden. Auch, damit er einen Teil seiner Gelder in die Entwicklung der Region
investiert – bevor jemand von der Staatsanwaltschaft zu ihm kommt Die
Staatsgewalt stellt ihn vor eine harte Alternative. Sie kam zu Abramowitsch:
Entweder du fährst auf die Tschuktschen-Halbinsel, wo man Menschen umsiedeln und eine Infrastruktur aufbauen muss, und bleibst
Besitzer von „Sibneft“ und deinem anderem Eigentum – oder du teilst das
Schicksal von Beresowskij und Gussinskij." - Irgendwas ist schiefgegangen; denn
2008 wird Abramowitsch auf eigenen Wunsch als Gouverneur entlassen, sein Amt
übernimmt Roman Kopin (geboren 1974). - Am 28.02.2013 treffen sich Russlands
Präsident Wladimir Putin und der Gouverneur Tschukotkas, Roman Kopin, um über
die sozialen und ökonomischen Probleme Tschukotkas zu beraten. Im Juli
2013 hat Roman Abramowitsch sein Amt als Duma-Vorsitzender auf Tschukotka
niedergelegt und auf alle Vollmachten des Abgeordneten des Parlamentsunterhauses
verzichtet. Der Multimilliardär begründete seine Entscheidung mit der Absicht,
„voll und ganz der Gesetzgebung der Russischen Föderation zu folgen“, weil das
neue Gesetz, das jüngst in Kraft getreten ist, Beamten verbietet, Vermögenswerte
im Ausland zu besitzen. Allerdings beabsichtigt Abramowitsch, sich auch
weiterhin am öffentlichen Leben auf der Tschuktschen-Halbinsel zu beteiligen.
"Abramowitsch,
ein junger Mann von 35 Jahren, gehörte zum Jelzinclan und ist im Zuge der so
genannten Privatisierung russischen Staatsvermögens auf dem Energiesektor in
den neunziger Jahren enorm reich geworden. Diese Privatisierung war in
Wirklichkeit ein cleverer Raubzug einiger weniger skrupelloser Männer, denen
von ihren Kumpanen in der Regierung oder im Apparat des Präsidenten die
Filetstücke der russischen Industriemonopole zugeschanzt wurden. Nicht
selten waren aber auch Betrug und Gewalt im Spiel, Konkurrenten wurden von
Auftragskillern erschossen. Es entstand die Klasse der Oligarchen´."
Thomas Roth in: Russisches Tagebuch,
2002.
Als Grenzgebiet
zu den Vereinigten Staaten ist Tschukotka für Ausländer nur mit
Sondergenehmigung zu bereisen, diese muss vom Gouverneur erteilt werden.
Als wir 1980 auf Tschukotka einreisten, war die Insel aus gleichem Grunde
ebenfalls Sperrgebiet. Wir Journalisten der FREIEN WELT erhielten damals als
erste Ausländer eine Genehmigung zur Einreise und wurden von Grenzsoldaten mit
Kalaschnikows (herzlich) empfangen. - 2002 machte der russische Föderationsrat in Moskau den Vorschlag, vom
Aussterben bedrohte Völker im hohen Norden Russlands mit weniger Wodka zu
beliefern, weil die Todesrate durch Alkohol unter den Tschuktschen, Nenzen und
Korjaken zwanzig Mal höher sei als bei den Russen, die in derselben Region leben.
-
"Nach übereinstimmenden
Berichten kann man sich die verderblichen Wirkungen des Alkoholgenusses bei
den Eingeborenen nicht schlimm genug vorstellen. Für wenige Schluck
Branntwein ist ihnen alles feil. Sie geben ihre guten Pelzwaren weg, die
ihnen während des strengen Winters allein ausreichenden Schutz gewähren
können. Im trunkenen Zustand sind sie ganz unzurechnungsfähig, so daß die
Weiber, um größeres Unheil zu verhüten, alsdann den Männern die Messer
wegnehmen. (...) Sowohl von der amerikanischen als auch von der
russischen Regierung ist der Handel mit Alkohol streng untersagt; trotzdem
wurde in früheren Jahren, besonders durch Händler aus Honolulu, mehrfach
Branntwein schlechtester Sorte fässerweise an sie geliefert."
Aurel (deutscher Naturforscher und
Ethnologe, 1848 bis 1908) und
Arthur Krause (deutscher Naturforscher
und Entdeckungsreisender,
1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und
zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882
- 2013 ist vor Tschukotka der südkoreanische
Fischfangtrawler "Oriental Angel" gestrandet. - Die Auftritte
weltberühmter Bühnenstars und bester Musik- und Tanzgruppen aus Russland
dauerten zur Olympiade in Sotschi (vom 7. bis 23. Februar 2014) mehr als
fünfhundert Stunden, auch Tscherkessen und Tschuktschen traten auf.
Kontakte zur Bundesrepublik
Deutschland: Zum
laufenden Arbeitsprogramm des Sibirienzentrums des Max-Planck-Instituts für
ethnologische Forschung gehört neben einer Reihe von anderen Themen die Frage
nach der Darstellung Sibiriens in den Medien und im gesellschaftlichen Diskurs.
Mehrere Projekte analysieren, wie in diesen Beschreibungen die Begriffe Kultur
und Natur gedeutet werden: "Beide Begriffe haben Einfluss auf das
Selbstverständnis einer Gesellschaft und besitzen auf Grund ihrer normativen
Bedeutung politische Relevanz. Sibirien gilt als eine Region, die erschlossen
und angeeignet werden muss. Dieses Verständnis von Aneignung impliziert große
Anstrengung und Opferbereitschaft, um die widrigen naturräumlichen
Voraussetzungen und die vielfach unterstellte Primitivität dieses Landstrichs zu
überwinden.
Interessant, zu wissen..., dass auf Tschukotka ein Tier
gesichtet und gefilmt (!) wurde, das wie ein Wollmammut aussieht.
Ein Ingenieur war gerade dabei, Land für den Straßenbau zu vermessen,
als er das Tier erblickte, dass durch einen eiskalten Fluss watete. Er griff
sofort zu seiner Videokamera… Vor etwa zehntausend Jahren durchstreiften
Wollmammuts die Erde in großer Zahl, seit ungefähr viertausend Jahren gelten sie
als ausgestorben. Wissenschaftler halten nun für möglich, dass in dem großen,
zum Teil noch unerforschten Territorium der TSCHUKTSCHEN einige Wollmammuts
überlebt haben. Warum auch nicht? Schien doch der Quastenflosser so ausgestorben
zu sein, wie Auerochse, Mammut und Brontosaurier. Der Ichthyologe James L. B
Smith sei "wie vom Donner gerührt" gewesen, als er erfuhr, dass eine Kollegin
ein Exemplar bei einem Fischer entdeckt habe. Er tat verdattert einen Ausspruch,
der in der Wissenschaftsgeschichte so berühmt geworden ist wie das
Wiedererscheinen des Quastenflossers: "Ich wäre kaum erstaunter gewesen, wenn
mir auf der Straße ein Dinosaurier begegnet wäre."
I
n der
Fremde mag es noch so sonnig sein,
Heimat
bleibt
Heimat.
Sprichwort der
Tschuktschen
Als Journalistin der
Illustrierten FREIE WELT – die als Russistin ihre Diplomarbeit über russische Sprichwörter geschrieben hat - habe ich auf allen meinen Reportagereisen in die
Sowjetunion jahrzehntelang auch Sprichwörter der dort ansässigen Völker
gesammelt - von den Völkern selbst, von einschlägigen Wissenschaftlern und
Ethnographen, aus Büchern ... - bei einem
vierwöchigen Aufenthalt in Moskau saß ich Tag für Tag in der Leninbibliothek. So
ist von mir erschienen:
*
Aus Tränen baut man keinen Turm,
ein kaukasischer Spruchbeutel,
Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten, Eulenspiegel
Verlag Berlin in zwei Auflagen (1983 und 1985), von mir übersetzt und
herausgegeben, illustriert von Wolfgang Würfel.
*
Dein Freund ist dein Spiegel,
ein Sprichwörter-Büchlein mit 111
Sprichwörtern der Adygen, Dagestaner Kalmyken,
Karakalpaken, Karelier, Osseten, Tschuktschen und
Tuwiner, von mir gesammelt und zusammengestellt, mit einer Vorbemerkung und
ethnographischen Zwischentexten versehen, die Illustrationen stammen von Karl
Fischer, die Gestaltung von Horst Wustrau, Herausgeber ist die Redaktion FREIE WELT, Berlin
1986.
*
Liebe auf Russisch,
ein in Leder gebundenes Mini-Bändchen im Schuber
mit Sprichwörtern zum Thema „Liebe“, Buchverlag Der Morgen, Berlin 1990, von mir
(nach einer Interlinearübersetzung von Gertraud Ettrich) in Sprichwortform
gebracht, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, illustriert von Annette
Fritzsch.
Ich bin, wie man sieht, gut damit
gefahren, es mit diesem turkmenischen Sprichwort zu
halten: Hast du Verstand, folge ihm; hast du keinen, gibt`s ja noch die Sprichwörter.
Hier
dreißig
tschuktschische Sprichwörter:
(Bisher Unveröffentlicht)
Je mehr Schüsse, je mehr
Fleisch.
Ohne gute Waffe ist ein Jäger kein Mensch.
Ein starker Mann darf seine Gefühle nicht zeigen.
Der Mensch ist keine Maus, er darf das Licht nicht fürchten.
Der Mensch ist der Gebieter seines Lebens.
Bedauernswert ein Mann ohne Söhne.
Wer keinen Durst hat, dem ist auch ein nahegelegener Fluss zu weit.
Ein leeres Gespräch führen ist dasselbe wie Schnee essen.
Einen Lügner anzuhören ist wie warmes Wasser trinken – es löscht nicht den
Durst.
Der ist ein schlechter Wirt, der erst an seinen Schlitten denkt, wenn Schnee
fällt.
Wegzehrung ist keine Last.
Fährst du für einen Tag, nimm Mundvorrat für eine Woche mit.
Der Tschuktsche sehnt sich nach Wärme wie nach einem
Festtag.
In einer Herde braucht´s Beine statt Arme.
Wer nicht fähig ist, den Verstand eines anderen einzuschätzen, hat selbst
keinen.
Nur ein schlechter Mensch stellt Bedingungen, wenn er Gutes tut.
Solange Rauch aus einer Jaranga* aufsteigt, ist Leben
darin.
Das Fett von heute macht blind für den Hunger von morgen.
Wert zu leben ist nur der Mensch, der Nahrung für seine Nachkommen beschaffen
kann.
Bei der Jagd ist dem Frühaufsteher der Erfolg beschieden.
Wahrer Schmerz kennt keine Tränen.
Das Glück kommt unverhofft.
Wer Gewissheit hat, dass der Sohn auf dem Weg des Vaters geht, braucht
keine
Sorgen zu haben, dass sein eigener Weg endet.
Hat der Mensch genug im Magen, lacht sein Herz.
Je mehr Rentierhäute in der Jaranga*, je mehr
Fröhlichkeit im Herzen.
Sei wie die Sonne, die niemanden bevorzugt.
Die Kleidung kann man auswechseln, das Herz nicht.
Ein Mann ohne Ehefrau verdient Spott.
Ein Dieb stiehlt, wenn der Wirt nicht zu Hause ist.
Kommt ein Gast zu dir und du hast kein Holz zum Heizen, zerhack deine Narte**.
Wie der Hirt, so die Herde.
* Jaranga = Wohnzelt
/ ** Narte = Schlitten
Gesammelt, aus dem Russischen übersetzt und in
Sprichwortform gebracht von Gisela Reller
Zitate:
"Die alten Tschuktschen erinnern sich noch gut an
die Geschäftsleute der amerikanischen Firma Hudson, die zwanzig Nähnadeln gegen zwanzig Weißfuchsfelle
tauschten und für 1 Pud (16,3 Kilo) Tabak zwanzig Fuchsfelle und dreißig
Paar Walrosshauer verlangten, die auf dem Weltmarkt teurer als
Elefanten-Elfenbein waren."
Neue Zeit vom 28. Dezember 1966
*
Was hat sich für die Tschuktschen durch ihre engen
Beziehungen
zur ehemaligen Sowjetunion als positiv, was als
negativ erwiesen...? "Positiv ist, dass
die Tschuktschen in die Entwicklungsprozesse des
Menschen von heute integriert wurden. Sie erhielten neuzeitliche Bildung, lernten die zeitgenössischen
Errungenschaften von Wissenschaft und Technik kennen. Sie wurden als Bürger in die Gesellschaft der
Sowjetunion integriert. Wie immer wir diese Gesellschaft - unter anderem wegen der Unterdrückung -
kritisieren, es war eine Gesellschaft eigenen Charakters. Besonders wichtig waren natürlich soziale
Errungenschaften, soziale Garantien, die es - ob gut, ob schlecht - gegeben hat. - Zu den negativen Erscheinungen
dieser Periode zähle ich die Erziehung zu einer sozialen Apathie, zu einer
Bürger-Fügsamkeit, zur Bereitschaft, Weisungen von oben zu folgen, die bekanntlich immer unanfechtbar und richtig
waren. Jetzt, da wir gewissermaßen auf halbem Weg ins Paradies uns selbst überlassen sind, wirkt
sich das Fehlen von Erfahrungen im Kampf der Bürger um ihre Bürgerrechte, um ihre
ökonomischen Rechte extrem nachteilig aus. (...) Unter der Alkoholisierung der Bevölkerung auf der
Tschuktschen-Halbinsel und im gesamten Norden haben wir schon vor der
Sowjetmacht gelitten, dann während der Sowjetmacht, während der Perestroika und
jetzt trotz Demokratisierung und ökonomischer Reformen - leiden
wir auch daran. (...) Was macht die Gewinne und Verluste der Zugehörigkeit eines kleinen
Volkes zur Russischen Föderation aus? Dieses Problem hat drei Aspekte. Der erste betrifft
die unverhohlene Kolonisierung, die militärische Unterwerfung, begonnen durch Kosaken-Formationen
und vollendet durch Formationen der Roten Garde. Der zweite Aspekt - die ökonomische Expansion. Der
dritte Aspekt - die ideologische. Alle drei sind Bestandteile der Politik.
Was die rein menschliche
Kommunikation betrifft, da sehe ich nichts als Positives. Die Russen können sich dank
ihres allgemein guten, sogar friedliebenden Charakters - ich meine das nicht von
Politikern instrumentalisierte Volk - mit jedem anderen Volk vertragen."
Juri Rytchëu
in einem Interview mit Leonhard Kossuth im Neuen
Deutschland vom 15. Dezember 1995
*
"Der Ehrgeiz kommunistischer `Nationalitätenpolitik
bestand darin, die Eingeborenen vom Volk der Tschuktschen zu `zivilisieren´ und
zu Sowjetbürgern umzuformen. Das zog eine komplette Veränderung ihrer Lebenswelt
und vieler ihrer Lebensgewohnheiten nach sich - im Positiven wie im Negativen.
Sie erhielten Schulbildung im Geiste des Kommunismus, erlernten Berufe. Doch sie
handelten sich einen entscheidenden Nachteil ein, der heute bei den Naturvölkern
einen großen Teil der Misere des russischen Nordens ausmacht: Die Abhängigkeit
der Eingeborenen verschob sich von der Natur auf den Sowjetstaat, seine
Siedlungen, seine Kolchosen, seine Infrastruktur. Seitdem all das entweder ganz
zusammengebrochen ist oder nur noch mehr schlecht als recht funktioniert, ist
den Menschen beides entzogen: Das traditionelle Leben in der Natur mit den
entsprechenden jahrhundertealten Überlebenstechniken einerseits und die
gesicherte Versorgung wie zu Sowjetzeiten üblich andererseits. In dieser
Zwickmühle leben die Menschen dort oben heute."
Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2002
*
"Die [Tschuktschen-]Kinder nahmen nie zuerst das
Fleisch aus der Schale, egal wie hungrig sie waren. Erst wenn
der Vater und Ernährer zu essen anfing, schnappten sie sich ein Stück. Außerdem
gehörte es
sich nicht für sie, das beste Stück zu nehmen, sondern das, was in der Nähe lag.
Diese Regeln betrafen vor allem die Jungen. Wenn ein zukünftiger Jäger ein Stück
nahm, das weit weg von ihm lag, dann flog
seine Harpune über das Walross hinweg. Außerdem war es nicht erlaubt, die
Knochen vom
Scheinbein zu essen, damit man sich nicht selbst das Bein brach."
Juri
Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Polarfeuer, 2007
Als Reporterin der Illustrierten FREIE WELT
bereiste ich 1980 Tschukotka. In meinem Buch „Diesseits und jenseits des
Polarkreises“, 256 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 1985 im Verlag Neues Leben,
Berlin, erschienen, habe ich über die Südosseten,
Karakalpaken,
TSCHUKTSCHEN
und asiatischen Eskimos geschrieben.
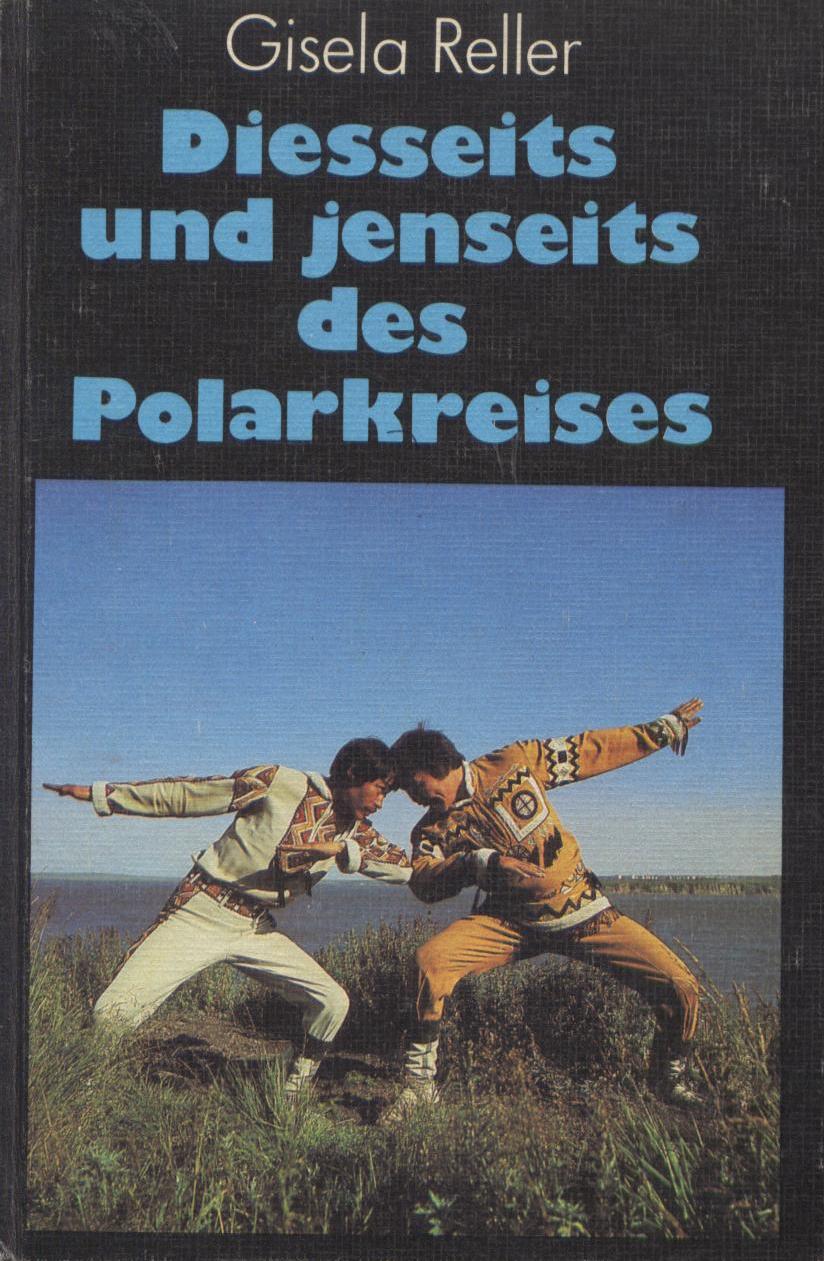
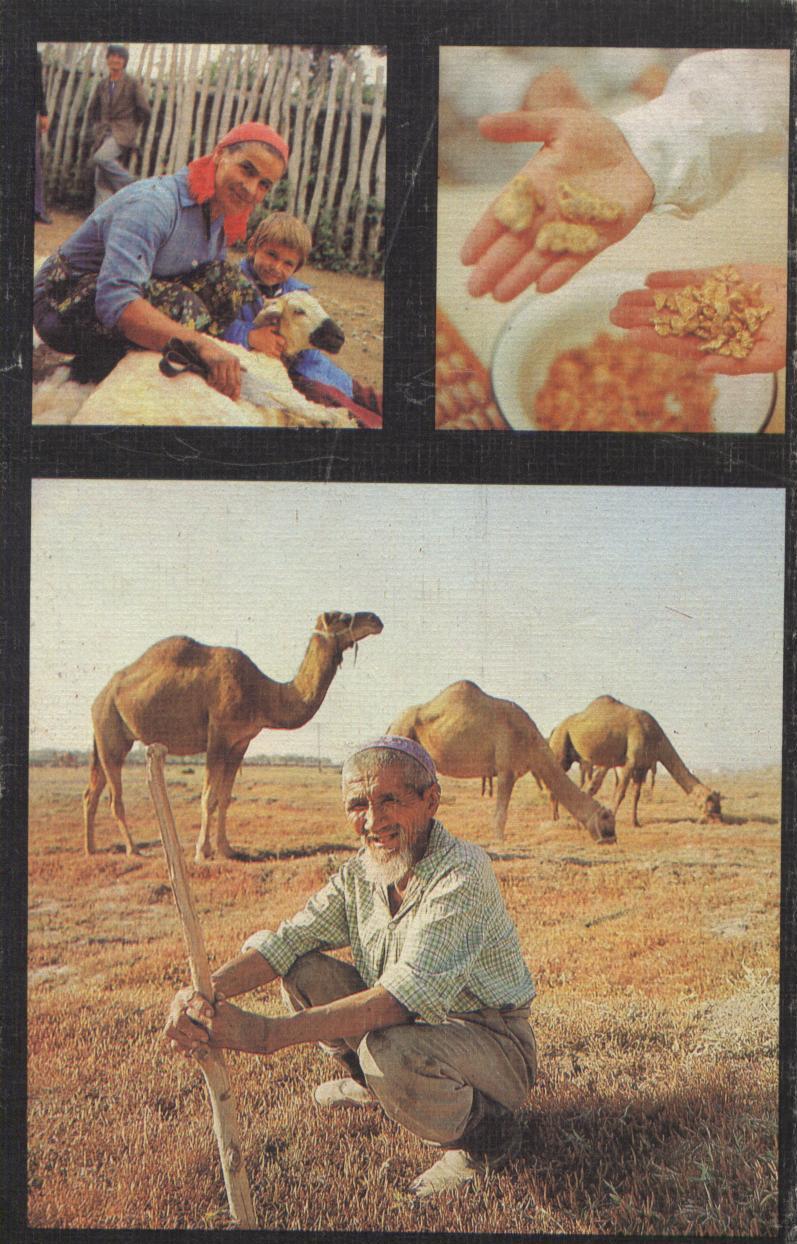
Magadan - keine tote Goldstadt
(LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des
Polarkreises")
"Eine 13 000
Kilometer-Reise ans `Ende der Welt´ machst du natürlich erst einmal zu Hause
mit dem Finger auf der Landkarte. Und so siehst du dann die Orte Magadan, Ola, Anadyr, Bucht Prowidenija, Kap Lorino, Lawrentija, Uëlen, Pewek, Bilibino...
Magadan, unser erstes Reiseziel, ist eine Hafenstadt am Ochotskischen Meer, besitzt einen Flugplatz und liegt noch
diesseits des Nördlichen Polarkreises. Eine Wirtschaftskarte verrät dir, dass
in Magadan die Grundstoff-, die metallverarbeitende,
die Nahrungsgüter- und Genussmittelindustrie zu Hause sind - die Angabe über
eine Genussmittelindustrie solltest du nicht ganz so ernst nehmen. Das schwarze
Kreuz im weißen Kreis den Standort eines Wärmekraftwerkes (das Wasserkraftwerk
ist noch nicht vermerkt); Farbflächen um Magadan
herum weisen dich auf intensiv genutzte Weideflächen und lichten Wald hin;
einer Geschichtskarte kannst du dann noch entnehmen, dass Magadan
seit Baubeginn 1929 bis 1974 um das Zwanzigfache gewachsen ist. Als Magadan 1939 Stadt wurde, wohnten schon 27 000 Menschen
dort.
Immerhin weißt du schon vor deiner Ankunft dort, dass dich 11 000
Kilometer von Moskau entfernt auch nicht gerade ein fernöstliches Dorf
erwartet.
"Demnach kamen
die ersten Häftlingstransporte im Jahre 1931 im Hafen der Stadt Magadan an.
In Schiffen wurden sie meist aus Wladiwostok hierher gebracht. Wie viele
Menschen bereits auf dem Transport verstorben sind, ist unbekannt. mit jedem
Jahr nahm die Zahl der Häftlinge zu, proportional zu den Terrorwellen des
Stalinschen Regimes. 1934 waren es bereits 20 000, 1937 kamen 70 000, 1939
die erschreckende Zahl von 138 000 und 1940 schließlich 190 000. Insgesamt
verschwanden im GULAG der Kolyma rund eine Million Häftlinge."
Thomas Roth in: Russisches Tagebuch,
2002
Uns erwartet auf dem Magadaner
Flugplatz erst einmal Grigori Kumbadse, der uns
sogleich lokalpatriotisch darauf hinweist, dass Moskau selbstverständlich der
erste Platz gebühre, Magadan aber auch nicht erst der
zweite.
Nanu? Schon ein erster Blick in sein tiefbrünettes adlernasiges Gesicht sagt
dir, dass Grigori ein waschechter Kaukasier ist. Woher dieser Nordstolz? `Ich lebe mehr als ein Jahrzehnt hier´, sagt er,
`und immer wenn ich im Süden im Urlaub bin, habe ich nach wenigen Tagen wieder
nach dem Norden Sehnsucht.´ Kolyma-Trasse, auf
der wir vom Flughafen in die Stadt fahren, ist die längste Straße der Welt: 1 600 Kilometer lang, führt sie
durch wilde Taiga und menschenleere Tundra bis
nach Jakutsk. Sie ist auch die `härteste´ Straße der
Welt, ab Ende der zwanziger Jahre erbaut, nur mit Hacken und Schaufeln; im
Winter knackende Fröste bis minus 60 Grad, vereiste Gebirge bis 2 000 Meter
Höhe; im Sommer lästige Mückeninvasionen.
Im Februar 1931, als die Straße
noch längst nicht fertig war, kam ein Hilfeschrei aus der Taiga. Die
Nahrungsmittel für die Arbeiter der Goldtagebaue gingen zur Neige. Aus
fünfhundert Kilometer entfernten Vorratslagern am Ufer der Nagajewbucht
wurde ein Pferdeschlitten mit Lebensmitteln losgeschickt. Doch er erreichte
nicht sein Ziel, blieb verschollen. Da rüstete man zwei Traktoren mit
angehängten Schlitten aus. Wieder fanden sich Menschen, die sich freiwillig auf
den lebensgefährlichen Weg machten. Nach 87 Kilometern verschwand der erste
Traktor mit fünf Schlitten unter dem Eis der Chasyn.
Ein zweiter Traktorenzug kam nur bis zum Karakumenaer
Pass, dann verwehrten ihm vier Meter hohe Schneewehen die Weiterfahrt. Da
unterbrachen die ohnehin schwer geplagten Straßenarbeiter ihre Arbeit. Zehn
Tage lang schaufelten fünfzig Männer jeweils vier Stunden lang bis zur
Erschöpfung die Schneeberge weg. Dann endlich war die eisige Wand durchbrochen,
und der zweite Traktorenzug konnte weiterfahren. Zwei Tage später funkten die
von Schnee, Kälte und Hunger geplagten Goldgräber dankbar: `Lebensmittel sind
angekommen. Danke.´ Bis heute ist die Kolyma-Trasse
die Lebensader des Magadaner Gebietes, denn noch gibt
es hier keinen einzigen Meter Eisenbahnlinie. Doch Schienen werden immer
nördlicher verlegt, schon ist nach der BAM (Baikal-Amur-Magistrale)
die JAM (Jakutische Magistrale) geplant, und bis zum
Jahre 2000 soll eine Eisenbahnstrecke bis zum Beringmeer führen. Bis jetzt aber
müssen noch 90 Prozent der Güter, in Häfen des Nördlichen Seeweges ausgeladen,
auf der Kolyma-Trasse weiterbefördert werden und: das
Gold der zehn Magadaner Goldtagebaue.
Der Autotransport ist hier wie Eisenbahnverkehr organisiert: Alle hundert
Kilometer befindet sich statt eines Bahnhofs ein Dispatcherpunkt mit
Reparaturwerkstatt und medizinischer Betreuung. Die Trassenfahrer müssen sich
dort melden, erhalten die neuesten Wetterinformationen, Route und Fahrplan
bestätigt und werden - unter Umständen - ins Bett gesteckt. Die medizinische Betreuung,
das Essen, die Kleidung zum Wechseln und die Übernachtung sind kostenlos. Auch
wenn der Fahrer ruht, der Motor arbeitet. Tag und Nacht ohne Pause, eine
Zerreißprobe für die Technik. Denn stünde der Motor auch nur eine viertel
Stunde still, wäre er bei minus 50 oder 60 Grad garantiert eingefroren.
War die Kolyma-Trasse für die Erbauer hart, so ist
sie es im acht Monate währenden Polarwinter nicht minder für die Fahrer; so
manchen Abschnitt bewältigt man lieber im Schritttempo. Wegen der Gefährlichkeit
der Trasse müssen immer wenigstens zwei Wagen gemeinsam auf Fahrt gehen. Bei
einer Havarie ist Reparatur auf der Strecke untersagt. Die Fahrer steigen
jeweils um und holen Hilfe vom nächsten Dispatcherpunkt. Sechsmal am Tag zählen
die Dispatcher die Lastwagen und melden sie per Funk weiter. Kommt ein Wagen
zur vorausberechneten Zeit nicht an, wird Alarm ausgelöst.
Die Kolyma-Fahrer sind als `Ritter der Trasse´ im
ganzen Sowjetland berühmt.
Unsere Fahrt auf der legendären Kolyma-Trasse dauert
ganze vierzig Minuten, dann präsentiert sich Magadan
als ganz und gar moderne Großstadt.
Wir dürfen uns im Hotel ein einziges Stündchen ausruhen, dann geht´s schon gleich - bei immerhin 15 Wärmegraden im August
- an die Besichtigung der nördlichsten Gebietshauptstadt.
Als Magadan in den dreißiger Jahren als `Goldstadt´
gegründet worden war, schrieb die `New York Times´, dass dieser Stadt ganz
sicher das gleiche Schicksal wie der kanadischen Großstadt Dawson beschieden
sei. Dawson, das war einmal die `Hauptstadt´ des Goldes, zur Zeit des letzten
´klassischen´ Goldrausches, als in Nordkanada und Alaska Gold entdeckt worden
war. Im Jahre 1898 bewegte sich ein Zug von etwa hunderttausend Goldhungrigen
von der Küste zu den Fundorten am Klondike. Der Weg
über den Chilkoot-Pass und am Yukon entlang bis nach
Dawson war lang, schwer und voller Gefahren. Man nimmt an, dass höchstens
vierzigtausend Menschen das Ziel erreicht haben. Kalifornien und Australien
hatte das Gold zu wirtschaftlichem Aufstieg verholfen. In den weitentlegenen
arktischen Regionen war es anders. Sobald die Goldfelder versiegt waren,
versanken diese Gebiete wieder in Vergessenheit. Dawson, das Zentrum des Yukon-Territoriums von Kanada hatte 25 000 Einwohner. Heute
leben dort 750 Menschen.
Für Magadan aber traf die Prophezeiung der `New York
Times´ nicht zu. Magadan ist heute eine quirlige
Großstadt mit fast zweihunderttausend Einwohnern. Hier arbeiten gegenwärtig
mehr Ärzte, Ingenieure und Lehrer als in jeder vergleichbaren Stadt der
nordamerikanischen Staaten. Umfragen im Gebiet Magadan
haben ergeben, dass jeder fünfte der vierhunderttausend Einwohner für immer
hierzubleiben gedenkt. Erfreulich. Und teuer. Um einen einzigen Menschen im hohen Norden
sesshaft zu machen, wendet der Staat fünfundzwanzigtausend Rubel auf.
Neben modernen auf granithartem Frostboden errichteten fünfstöckigen
Steinhäusern sehen wir auch das alte Holzhütten-Magadan
direkt am Meer. An dessen Sandstrand sonnen sich heute bei für nördliche
Verhältnisse selten hochsommerlichem Wetter viele Magadaner.
Baden gehen allerdings nur Tollkühne, denn das Ochotskische
Meer wird nie wärmer als sieben Grad Celsius. `Bald werden sich alle ins Wasser
wagen können´, behauptet Grigori Kumbadse, denn:
`Meereswasser soll durch eine schmale Schleuse in flache Teiche abgelassen
werden, wo es auf Badetemperatur erwärmt wird. Wo sollen die Kinder denn sonst
schwimmen lernen? Die niedrigen Wassertemperaturen sind ja der Grund dafür,
dass keiner von den Einheimischen schwimmen konnte, auch kein einziger
Meerestierjäger.´
Städtebaulich hat man mit Magadan einiges vor. Damit
jeder, der hier bleiben will, wenigstens fünfzehn Quadratmeter komfortablen
Wohnraum erhält, gibt es einen Generalbebauungsplan. Jährlich werden
hunderttausend Quadratmeter Wohnraum gebaut. Nur die Hälfte allerdings ist
Zuwachs, mit der anderen Hälfte wird der Abriss ganzer Straßenzüge ersetzt -
Krieg den Hütten. Viele Architekten sehen jedoch nach wie vor Holz als
wichtigsten Baustoff des Nordens an. Steinhäuser weisen immerhin dreimal mehr
Wärmeverluste auf. Und so gibt es auch schon Projekte für zehngeschossige
Häuser aus Holz.
Bis ins Detail haben Magadans Planer die widrigen
Klimabedingungen in ihre Überlegungen einbezogen. Die neuen Viertel sind
terrassenförmig angelegt, lange Häuserreihen im Neubaugebiet an der Nagajewbucht sollen die Wucht des Seewindes brechen. Die
Wohnhäuser werden abgerundete Ecken haben, wohldurchdachter zusätzlicher Schutz
gegen den unablässig wehenden rauen Wind. Die Erdgeschosse der Häuser sind zur
Unterbringung von Schlitten, Skiern und Stiefeln vorgesehen; zu jeder Wohnung
gehört ein belüfteter Schrank zum Trocknen von Wäsche und Oberbekleidung.
Außerdem sind große Treppenflure und Korridore projektiert -
Kommunikationszentren mit Cafés und Gaststätten. Ohne sich bei unwirtlichen
Temperaturen auf die Straße begeben zu müssen, kann jeder, der will, Mensch
unter Menschen sein. Auch über die Farbigkeit der Wohnungen hat man sich
Gedanken gemacht. Die Natur ist in Magadan nicht
gerade farbenreich, vor allem natürlich nicht in der Zeit des langen Winters.
Da sich diese farbliche Eintönigkeit auf die menschliche Psyche auswirken kann,
wird hier ein kräftiges Rot, Blau oder Grün bei Häuserfassaden und
Zimmertapeten dominieren - ganz im Sinne unseres Grigori Kumbadse.
Er nimmt das geplante Grell der Fassaden gleich zum Anlass, uns über die
Gefährlichkeit der Farbe Weiß die Augen zu öffnen. (Seinen alten Bekannten hat
er da sicherlich schon nichts Neues mehr zu sagen.) `Gesund lebt nur´, sagt er
im Brustton der Überzeugung, `wer alles Weiße in der Nahrung meidet: Milch,
Käse, Butter, Zucker...´ - `Und Wodka´ frage ich scheinbar arglos. `Auch
Wodka´, bleibt Grigori Kimbades konsequent. (Wie wir bald merken werden, hat er
gegen die Farbe Braun nichts einzuwenden.) Im sommerlichen Magadan
weisen dich auf den ersten Blick nur die Häuser auf Pfählen - die
`Luftkissenhäuser´ und die durchweg vom Sturm geköpften Lärchen darauf hin,
dass du durch eine Stadt des hohen Nordens schlenderst. Frost multipliziert mit
der Sturmstärke ergibt die Strenge des Klimas. So haben Wissenschaftler für die
verschiedenen nördlichen Gebiete unterschiedliche Rauheitsgrade ermittelt. Der
Autonome Bezirk der Tschuktschen - nördlichstes Territorium des Magadaner Gebietes - gilt als die unwirtlichste Gegend des
gesamten hohen Nordens. In der Stadt Magadan liegt
die Durchschnittstemperatur im Januar bei minus 34 Grad, die durchschnittliche
Windgeschwindigkeit beträgt zwölf Meter je Sekunde. In den westlichen
Landesteilen schließen bei solchem Mordswetter die Schulen, wird auf Tagebauen
und Baustellen die Arbeit eingestellt. Kein Leben mehr unter freiem Himmel.
Nicht so im hohen Norden, wo die Technik weit härteren Bedingungen angepasst
ist. Und der Mensch?
Da weiß unser Farbapostel Erstaunliches zu sagen: `Der Kaukasus ist als Land
der Langlebigen weltbekannt. Aber wer weiß schon, dass von dem eisigen Jakutien
zu Recht der zweite Platz beansprucht wird? Die Besonderheiten der nördlichen
Natur veranlassen unseren Organismus zu einer Arbeit mit höheren Drehzahlen.
Sowohl in unserem Nervensystem als auch in unserem Herz- und Gefäßsystem
vollziehen sich Veränderungen, auch das Atmungssystem stellt sich um. In
Gegenden mit extrem rauem Klima erreicht der Mensch bestimmte Grenzwerte der
Auslastung. Die Folge ist eine größere Widerstandsfähigkeit des Organismus. Ich
kenne einen Polarmediziner, der die Meinung vertritt, dass es schon bald eine
neue Kur- und Erholungszone in der Sowjetunion geben wird: die Polarzone - für
die Behandlung von Stress und anderen Begleiterscheinungen des Stadtlebens.´
Sanatorien im hohen Norden. Ein aufregender Gedanke. Doch wir mit unserem
unangepassten Organismus sind fürs erste froh, in der `Komfortperiode´ im hohen
Norden zu sein."
Was ich
damals wusste: Seit der russischen
Eroberung des Fernen Ostens im 17. Jahrhundert vermutete man reiche
Bodenschätze in der Kolyma-Region, dem Gebiet
zwischen Lena und Pazifischem Ozean. Die ersten Geologen kamen über die
klassische Eroberungsroute entlang der Lena nach Jakutsk.
Von dort konnte man im Winter per Schlitten weiterreisen. Somit dauerten
Reisen, die lediglich die grobe Erkundung der Gegend zum Ziel hatten, oft viele
Jahre. Mit Fertigstellung der Transsibirischen Eisenbahn ergab sich eine
zweite Anreisemöglichkeit, die gerade für das Erreichen des östlichen
Kolyma-Gebietes, erhebliche Zeitersparnis bedeutete. Diese
Zeitersparnis nutzten nicht nur die zum Erforschen der Bodenbeschaffenheit
beschäftigten Wissenschaftler, sondern auch die Organisatoren von
Gefangenentransporten.
*
Was ich damals
nicht
wusste: Galt
die im zaristischen Russland ausgesprochene Verbannung von
"Staatsfeinden" oft nur bis Mittelsibirien – was trotzdem viele
Wochen Fußmarsch bedeutete – so hatte die stalinistische Sowjetunion eine
Möglichkeit gefunden, mittels der Transsibirischen Eisenbahn bis Wladiwostok
und der anschließenden Schiffspassage nach Magadan,
Tausende von Gefangenen relativ schnell bis in die Kolyma-Region
zu bringen. Um bis zu den Bodenschätzen zu gelangen, musste man eine Straße
anlegen, die sogenannte Kolyma-Trasse. Aus wie vielen
Nationen und Völkerschaften die Gefangenen kamen, die unter unmenschlichen
Bedingungen in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts die Straße bauten
und sie bis in die fünfziger Jahre in Ordnung hielten, ist unbekannt. Ebenfalls
unbekannt ist, wie viele Menschen beim Bau der Straße und in den Lagern zu Tode
kamen. Man sagt, dass auf der gesamten Länge von etwa
zweitausend Kilometern unter der Straße etwa alle drei Meter eine Leiche
liegt, deshalb auch "Straße der Knochen" genannt.
Verse
einer Wilden (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des
Polarkreises")
„Die Sehnsucht nach dem
fernen Tschuktschenland hatte Juri Rytchëu,
der erste Schriftsteller der Tschuktschen, in mir geweckt. In seinen Büchern
`Traum im Polarnebel´, `Menschen an fremdem Gestade´ und `Abschied von den
Göttern´ hat er sein Volk so liebenswert beschrieben, dass ich mir als
Fünfzehnjährige vornahm, eines Tages die `Am Rande der Welt´ lebenden
Tschuktschen kennenzulernen.
Nun – ich bin dreiundvierzig Jahre alt - ist dieser Tag da.
In Magadan öffnet sich uns die erste Tür. Wir sind
Gäste Antonina Kymytwals, der ersten Dichterin der
Tschuktschen.
Man bittet uns ins Wohnzimmer: ein großer Ausziehtisch (`Wir haben oft
Gäste.´), vier Stühle, eine Couch, zwei Sessel, ein großer verglaster
Bücherschrank, ein Radiogerät, ein Fernsehapparat. Nur Kleinigkeiten, die es
erst ausfindig zu machen gilt – Figürchen aus Walrosselfenbein, `Bilder´ aus Robben-
und verschiedenfarbigen Rentierfellen, Bücher in tschuktschischer
und eskimoischer Sprache -, erinnern dich daran, dass
du in einem Haus hinter dem Polarkreis bist. Die Inneneinrichtung der
3-Zimmer-Wohnung – Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer – unterscheidet sich
nicht von der Innenausstattung einer mitteleuropäischen Wohnung. Das Besondere
ist lediglich, dass sie auf ungewöhnlichem Weg - dem Nördlichen Seeweg -
hierher gelangt ist. Auf dem gastfreundlich reich gedeckten Tisch neben
Rentierzunge, geraspeltem rohem Fleisch, eingelegtem Walfleisch (Geschenk von
Verwandten aus Tschukotkas Hauptstadt Anadyr)
durchaus Gewohntes: Brot, Butter, Wurst, Eier, Bratkartoffeln. Das Gewohnte
wird nur dadurch ungewöhnlich, dass diese Lebensmittel noch vor etwa fünfzehn
Jahren auf Tschukotka unbekannt waren.
Die Tschuktschin Antonina Kymytwal
hat tiefschwarzes Haar (wie alle Tschuktschen), dunkelbraune Augen, ein ganz
waches, schönes Gesicht. Die Augen sind asiatisch schmal, die Nase tschuktschisch breit, sie hat auffallend energisch
geschwungene Lippen. Das großgeblümte, sehr grellfarbige Kleid umhüllt einen
fülligen Körper. (`Ich sitze und – esse zuviel.´)
Antonina Kymytwal wurde 1938 als Tochter eines
Rentierhirten geboren, in der Tschaunskaja-Tundra, in
einer Jaranga aus Rentierfell. Acht Jahre zuvor war
der Autonome Bezirk der Tschuktschen gegründet worden. Aber noch immer
versprach man seine Töchter den Eltern altersmäßig geeigneter Knaben. Auch
Antonina Kymytwal…
Als sie auf die Welt kam, war die tschuktschische
Schriftsprache gerade erst sieben Jahre alt. Ins ferne Tschuktschenland
gelangte das von russischen Wissenschaftlern ausgearbeitete Alphabet auf dem
Eisbrecher `Litke´, dem zweiten Schiff, das den
Nördlichen Seeweg ohne Überwinterung in einer einzigen Navigationsperiode
bewältigt hatte.
Europa und Asien waren sich näher gekommen.
Ganz nahe kamen sie sich in der Magadaner
Gagarinstraße, als Antonina Kymytwal 1960 einen
Russen heiratete. Es war Liebe auf den ersten europäisch-asiatischen Blick, da Vitali
Sadorin als Redakteur einer Zeitung für
Rentierzüchter unterwegs in der Tundra, der Lehrerin Antonina Kymytwal begegnete. Sie riskierte den Bruch mit der
Familie, als sie sich an den zweiundzwanzig Jahre zuvor für sie Bestimmten
nicht gebunden fühlte. Nur schwer fanden sich ihre Angehörigen damals mit einem
Tatbestand ab, der zwei Jahrzehnte später auch im hohen Norden schon Alltag
ist: Jede siebente Ehe wird in sowjetischen Zeiten zwischen Personen
verschiedener Nationalität geschlossen, auf den Komsomol-Großbaustellen ist
sogar jede zweite Ehe national gemischt. Da die Kinder aus diesen Ehen mit
sechzehn Jahren selbst bestimmen, ob sie die Nationalität des Vaters oder die
der Mutter annehmen wollen, frage ich die beiden Töchter der Familie Kymytwal-Sadorin – die Bestschülerin Ljuba und den Wildfang
Nastja – ob sie einmal Russinnen oder Tschuktschinnen sein wollen. Es ist für beide keine Frage,
sie werden Tschuktschinnen sein. Und Vater Sadorin sagt dazu lachend: `Ich bin auch schon ein
richtiger Tschuktsche geworden, nur sieht man es mir
äußerlich nicht an.´
1963 erschien Antoninas erster Lyrikband „Lieder des Herzens“, zweisprachig – tschuktschisch und russisch – in einer Auflage von
vierzigtausend Exemplaren. Es folgten Bücher mit Versen für Kinder und weitere
Lyrikbände für Erwachsene; sie schrieb auch Theaterstücke. Wir bitten Antonina Kymytwal, uns einige Gedichte vorzulesen – geschrieben in
der Tschuktschensprache. Ein Professor Egli hatte diese Sprache 1882 geringschätzig als ein
`Mittelding zwischen Entengeschnatter, Rentierröcheln und Hundegebell´
beschrieben. Wir lauschen der kehligen Tschuktschensprache
mit Vergnügen – bei geräuchertem Rentierfleisch und schwarzem Tee (für den die
Tschuktschen einst ihre letzte Kuchljanka – die
durchgehende Fellbekleidung – hergaben). Bei vielen Worten machen die
Tschuktschen einen phonetischen Unterschied, je nachdem, ob die Worte ein Mann
oder eine Frau spricht. Obwohl Antonina Kymytwals
Gedichte in einer ganz fremden, ungewöhnlichen Sprache an mein Ohr dringen,
erscheinen sie mir zart und weich, zum Beispiel im Gedicht:
Die Uhr / Die Uhr blieb stehen. Kein Zustand! / Einen Ausweg finde
ich schnell, / Vorwärts, zurück – wie´s kommt – /
Wird der Zeiger gestellt. // Meine Uhr bleibt nicht müßig, / An die Arbeit
macht sie sich neu. / Sekunden knacken wie Nüsse / Wird sie eifrig im Einerlei.
// Mutter, deines Lebens Zeiger / möchte ich zurückdrehen sacht, / Dass
langsam, behutsam, leise / Sie neu gehen übers Zifferblatt.// Heiterer würdest
du blicken… / Fester würde der Rücken und grad, / Und die Netze der Falten
dünner, / Und das graue Haar wieder schwarz. // Doch das Jahrhundert mahlt Tage
wie Körner. / Irgendwohin treibt die Jahre die Zeit. / Nur die Liebe ist
imstande, anzuhalten / Ihren Gang bis zur Unendlichkeit…//
Nachdichtung:
Jeremias Weinstock

Die
tschuktschische Lyrikerin Antonina Kymytwal mit ihrem russischen Mann Vitali und
den beiden Töchtern Ljuba und Nastja.
Foto: Detlev Steinberg
Antonina Kymytwal
besingt die Tundra, ihre Bewohner, die `Wärme und Licht ausstrahlen´, Tschukotka, `wo jede Begegnung ein Glücksfall´ und die Luft
Freude spendend und `rein wie ein Puschkinscher Vers´ ist.
Jahrhunderte lang wurden die Tschuktschen von Forschungsreisenden,
Pelzhändlern, Schiffbrüchigen… als `roh´ und `wild´ charakterisiert. Die
mandeläugige Asiatin Antonina Kymytwal ist mir in den
wenigen Stunden unserer Bekanntschaft so vertraut geworden, dass ich keine
Hemmungen habe, ihr auch unangenehme Fragen zu stellen.
Ja,
bestätigt sie, die Tschuktschen haben früher ihre alten, kranken Eltern
umgebracht – `damit sie zu den ´oberen Menschen´ gehen konnten, ohne sich lange
quälen zu müssen´.
Ja, so Antonina Kymytwal,
es entspricht durchaus der Wahrheit, dass die Tschuktschen oft ihre neugeborenen
Töchter erwürgten - `wenn unweit kein gleichaltriger Knabe lebte, schon gleich
zu ihrem Ernährer bestimmt.´.
Ja, so Antonina Kymytwal,
die Tschuktschen wuschen sich fast nie – religiöse Riten verboten das,
`vielleicht, weil es bei unserer Lebensweise in dieser unbeschreiblichen Kälte
zu lebensgefährlichen Erkrankungen und Erfrierungen hätte kommen können.´
Ja, so Antonina Kymytwal, die Tschuktschen
bevorzugten wie die asiatischen Eskimos rohes Fleisch und rohen Fisch – `weil
es – über eine Moosfunzel gekocht – viele Stunden gedauert hätte, bis es
endlich gar gewesen wäre´.
Hatten die Fremden ihren Abscheu vor dem Unbekannten überwunden, fanden sie oft
sogar Gefallen daran. So schreibt der amerikanische Publizist George Kennan, der im Auftrag der Russisch-Amerikanischen
Telegraphen-Gesellschaft (sie sollte von Alaska nach Sibirien Telegraphendrähte
spannen) von 1865 bis 1868 Nordostasien bereiste: `Was ich für Hobelspäne
gehalten hatte, waren rohe, gefrorene Fische, die geraspelt eine Delikatesse
sind, mit der ich später sehr vertraut wurde…´
"Gegenwärtig gibt
es auf Tschukotka außer der Dichterin Antonina Kumytwal leider keine
weiteren bemerkenswerten literarischen Erscheinungen."
Juri Rytchëu(tschuktschischer
Schriftsteller, 1930 bis 2008;
in über 30 Sprachen übersetzt), 1995
Besonders hart stimmt aus zivilisierter Welt der einstige Vorwurf, dass die
Tschuktschen teilnahmslos zusehen können, wenn ihre Stammesbrüder verhungern –
`dann nämlich´, so Antonina Kymytwal, `wenn sie
bereits selbst vom Hungertode gezeichnet waren´.
Und das waren die `wilden´ (sprich: auf niedriger Kulturstufe stehenden)
Tschuktschen oft, in fast jedem Frühjahr, wenn die Vorräte zur Neige gingen,
aber der ‚Winter kein Ende nehmen wollte´.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts starben ganze Niederlassungen auf Tschukotka aus, als die auf unbestritten höherer
Kulturstufe stehenden Niederländer, Deutschen, Engländer, Franzosen, Amerikaner…
den Wal `wie die Wilden´ nahezu ausgerottet hatten.
Die `wilden´ Tschuktschen – die mindestens vier verschiedene Worte für
`Freundschaft´ besitzen, kein Wort aber, das unserem Wort `Krieg´ entspräche –
töteten nie mehr Tiere, als sie für sich und die Ihren benötigten.
Die erste Flasche mit dem `Getränk aus der goldenen Wurzel*´ sei leer geworden
beim Gespräch über die Tschuktschen, sagt Witali Sadorin, die zweite mögen wir bitte gemeinsam leeren bei
einem Gespräch über die Deutschen. (…) Aus der dritten Flasche nehmen Antonina Kymytwal und ich – es ist nun schon weit nach Mitternacht
nur noch einen symbolischen Schluck. Wir trinken vor Freude darüber, in
allerletzter Minute noch von einander erfahren zu haben, das `meine erste
leibhaftige Tschuktschin´ dem gleichen Hobby frönt
wie ich: Wir sammeln beide Sprichwörter der Völker der Sowjetunion.
Diese zehn noch unveröffentlichten tschuktschischen
Sprichwörter, schnell noch
von mir notiert, sind ein Geschenk an mich, denn auch der Tschuktschin Antonina saßen heute Deutsche
erstmalig leibhaftig gegenüber.
Das Glück
kommt nur zu dem, der ihm entgegengeht.
Schlecht der Alte, der keinen Jungen auf seinen Pfad führt.
Die Not fragt nicht danach, was für Wetter ist.
Fürchte die Schande mehr als den Frost.
Gute Nachrichten sind keine Last für den Schlitten.
Nur den Einsamen macht unser Wind frieren.
Mach dir nichts Überflüssiges zu Eigen.
Ohne Licht und Wärme ist der Mensch wie ein Seehund ohne Luft.
Zu frohen Menschen kommt der Erfolg eher.
Jeder Schneesturm hat seine Eigentümlichkeiten, ebenso wie die Menschen.“
* Was bedeutet die
"goldene
Wurzel“?
Berühmt für ihre Kräuter sind das
Tunka-Tal
und das Sajan-Gebirge in Ostsibirien. Geradezu
berühmt ist hier ein Verwandter der Ginseng-Wurzel: die Goldwurzel, ihr wird aphrodisische Wirkung zugeschrieben.
"Bekenntnisse"
des hohen Nordens
(LESEPROBE
aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Am Pädagogischen Hochschulinstitut Magadans sind Aufnahmeprüfungen. An vier Fakultäten (eine
physikalisch-mathematische, eine historische, eine philologische und eine
pädagogisch-mathematische Fakultät für die Unterstufe) studieren jährlich
zweihundertfünfzig junge Leute, vorrangig Vertreter der Völker des hohen
Nordens, die im Gebiet Magadan ansässig sind, von
alters her Tschuktschen und asiatische Eskimos.
Die Tschuktschen unterschieden sich entsprechend ihren Erwerbszweigen in Küsten-Tschuktschen - die am Meer wohnten und sich von der
Meerestierjagd ernähren - und in Rentier-Tschuktschen
- die in der Tundra leben und Rentiere züchten. Die Rentier-Tschuktschen
waren zum Nomadenleben gezwungen, sommers und winters zogen sie mit ihren
Rentieren und ihrem ganzen Hausrat von Weideplatz zu Weideplatz. Die Küsten-Tschuktschen waren sesshaft wie die asiatischen
Eskimos, die sich etwa im 17./18. Jahrhundert mit den Küsten-Tschuktschen,
mit denen sie sich denselben Lebensraum teilten, zu vermischen begannen;
allerdings bewahrten die Eskimos viele ihrer Bräuche und auch ihre Sprache.
Mitte des 19. Jahrhunderts begannen auch sie in Jarangas
- einem Kuppelzelt aus Rentierfellen - zu leben. Bis dahin wohnten sie in
Erdhütten, die in ihrer Sprache `Mytygak´ heißen;
Iglus bauten die asiatischen Eskimos im Gegensatz zu den amerikanischen Eskimos
nie. Die Eskimos erhielten ihren Namen (`Rohfleischesser´) von den Indianern;
die Eigenbezeichnung der asiatischen Eskimos ist seit alters `yigyt´ (`wahrer Mensch´). Kein einziges zahlenmäßig so
kleines Volk ist geographisch so weit verbreitet wie das Volk der Eskimos; 25
000 Eskimos leben in Kanada, 20 000 auf Alaska, 4 000 auf Grönland, 1 500 in
der Sowjetunion. Man nimmt an, dass alle Eskimos einst Stammesbrüder waren, bis
sie durch das Entstehen der Beringstraße getrennt wurden. Sprachforscher
entdecken noch heute viele Ähnlichkeiten in den Sprachen aller Eskimos.
Doch zurück in den Prüfungsraum des Magadaner
Hochschulinstituts. Gesetz des hohen Nordens ist, dass stets der angestammte Nordbewohner bevorzugt wird, wenn für einen
Studienplatz mehrere Bewerber vorhanden sind. Für sie finden die
Aufnahmeprüfungen ohne Konkurrenz statt, egal, wie sie bestehen, sie werden
grundsätzlich immatrikuliert. An allen Fach- und Hochschulen stehen die Türen
sperrangelweit offen für die Vertreter der Völker, die noch vor einem halben Jahrhundert
glaubten, dass die Schrift nur `eine stumme Botschaft der Weißen´ sei.
Als in Anadyr der erste Sowjetkongress abgehalten werden sollte, war es ein
Problem, alle Delegierten von Tschukotka an ein und
demselben Tag zu versammeln; denn ein Kalender war den Einheimischen unbekannt.
Und so fuhren die Veranstalter des Kongresses fast ein ganzes Jahr vorher zu
allen Ortschaften, Niederlassungen und Rastplätzen, um den Delegierten zu
erklären, wie sie den Tag des Kongresses berechnen konnten. Man schnitt
gemeinsam Kerben in Stöcke und legte fest, wie viele Kerben `abgehakt´ sein
mussten, bis man zum `Redefest´ aufzubrechen habe. Der gekerbte Stock war eine
große Neuheit, denn Tschuktschen und Eskimos waren es gewohnt, alles an Händen
und Füßen zu berechnen. Bei großen Zahlen holte man die Nachbarn um auch deren
Finger und Zehen wie Rechenstäbchen zu gebrauchen. Allerdings gab es nur selten
große Zahlen. Sogar für den Tauschhandel mit den Amerikanern reichten
gewöhnlich die Finger einer Hand aus: ein Kupferkessel für zwei Fuchsfelle oder
vier Rentierhäute; ein Beil für drei Fuchsfelle. Erstaunlich, dass die
Rentierhirten, ohne je ihre Rentiere zu zählen, sofort bemerkten wenn auch nur
ein einziges Tier fehlte.
Das alles ist noch kein halbes Jahrhundert her. Deshalb wollen wir von Raissa Ragschyschwal,
verantwortlicher Sekretär für die Aufnahmeprüfungen, wissen, inwiefern sich tschuktschische und eskimoische
Studienbewerber von den zugereisten Bewerbern
unterscheiden. Raissa Ragschyschwal,
seit acht Jahren am Institut´, sagt: `Die meisten unterscheiden sich nicht
voneinander durch Kenntnisse und Leistungen, der Unterschied besteht im
Charakter. Die Mädchen und Jungen der kleinen Nordvölker sind verschlossener,
schweigsamer, bescheidener und sehr empfindsam. Die einen sind in der Stille
der Tundra aufgewachsen, fernab von vielen Menschen, die anderen waren von
klein auf in Internaten, nur selten bei ihrer Familie. Sie brauchen viel
Zuneigung und wir viel Fingerspitzengefühl.´
Wir müssen leider `auf die Schnelle´ versuchen, einen Blick in ihre Seelen zu
werfen. Bei einem Gesellschaftsspiel legte sich die Familie (Karl) Marx
gegenseitig einen Fragebogen vor; die Beantwortung der Fragen sollte eine Art
`Bekenntnis´ darstellen. Wir haben nur jenen Fragebogen ins Russische
übertragen und ihn - die Aufnahmeprüfungen im Magadaner
Hochschulinstitut nutzend - zwanzig Tschuktschinnen
im Alter von 16 bis 18 Jahren vorgelegt. Die Antworten der zukünftigen
Lehrerinnen:
Ihre (eigene) Lieblingstugend: Fröhlichkeit (15), Gerechtigkeitssinn
(3), Fleiß (2); bei Karl Marx: Einfachheit.
Ihre Lieblingstugend beim Mann: Tapferkeit (12), Willensstärke (2),
Standhaftigkeit (2), Frohsinn (2), Feingefühl (1), Optimismus (1); bei Karl
Marx: Kraft.
Ihre Lieblingstugend bei der Frau: Güte (14), Zärtlichkeit (4),
Bescheidenheit (1), Strenge (1); bei Karl Marx: Schwäche.
Ihre Haupteigenschaft: Schüchternheit (6), Unnachgiebigkeit (3), jedem
die Wahrheit sagen (3), sich auf andere Menschen einstellen können (2), andere
Menschen achten (2), Nachgiebigkeit (2), Beharrungsvermögen (1) Ehrgeiz (1); bei
Karl Marx: Beharrlichkeit des Strebens.
Ihre Auffassung vom Glück: verstanden zu werden (9), anderen Nutzen zu
bringen (4), seinen Platz im Leben zu finden (3), einen geliebten Menschen neben
sich zu haben (3), zu leben (1); bei Karl Marx: zu kämpfen.
Ihre Auffassung vom Unglück: in der Not allein zu sein (8), von einem Freund
verraten zu werden (3), einen geliebten Menschen zu verlieren (4), Misserfolg
zu haben (2), eine schlechte Zensur zu bekommen (1), glauben, sich ducken zu
müssen (1), der Umwelt gleichgültig zu sein (1); bei Karl Marx: Unterwerfung.
Das Laster, das Sie am ehesten entschuldigen: irren (15), Dummheit (2),
Jähzorn (1), Neugierde (1), Zerstreutheit (1); bei Karl Marx: Leichtgläubigkeit.
Das Laster, das Sie am ehesten verabscheuen: Verlogenheit (10), Egoismus
(4), Grausamkeit (4), Überheblichkeit (1), Feigheit (1); bei Karl Marx:
Kriecherei.
Ihre Abneigung: Hat niemand beantwortet, wahrscheinlich war die
Fragestellung nicht eindeutig genug formuliert; bei Karl Marx: Martin Tupper (ein zeitgenössischer Schriftsteller).
Ihre Lieblingsbeschäftigung: nähen, stricken, sticken (6), Sport (3),
Beeren sammeln (3), Gedichte lesen (3), fotografieren (2), singen (2),
fernsehen (1); bei Karl Marx: herumstöbern in Büchern.
Ihr Dichter: Alexander Puschkin (5), Antonina Kymytwal
(5), Sergej Jessenin (3) Viktor Keulkut (2), Viktor Nekrassow (2), Rassul Gamsatow(1), Wladimir Majakowski (1), Soja Neuljumkina (1); bei Karl Marx: Shakespeare, Äschylus, Goethe.
Ihr Schriftsteller in Prosa: Juri Rytchëu (12),
Boris Wassiljew (2), Maxim Gorki (1), Pjotr Proskurin (1) Wassili Schukschin (1), Tschingis Aitmatow
(1), Nikolai Ostrowski (1), Alexander Fadejew (1); bei
Karl Marx: Diderot.
Ihr Held: Pawel Kortschagin (8), Alexander Matrossow (5) Rachmetow (3), John
Lennon (2), Eugen Onegin (2); bei Karl Marx: Spartakus, Kepler.
Ihre Heldin: Soja Kosmodemjanskaja (10), Natascha Rostowa (3), Gestalten aus tschuktschischen
Märchen und Sagen (7); bei Karl Marx: Gretchen.
Ihre Blume: Vergissmeinnicht (5), Kamille (5), Rose (4), Schneeglöckchen
(2), Kornblume (1), Gladiole (1), Nelke (1), Aster (1); bei Karl Marx: Lorbeer.
Ihre Farbe: Blau (18), Grün (1), Rot (1); bei Karl Marx: Rot.
Ihr Lieblingsname: Alexander (3), Wladimir (3), Irina (3), Olympiada (2), Swetlana (1), Sergej (1) Wassili
(1)Tatjana (1), Aljoscha (1) Valentina (1) Kostja (1), Shenja
(1), Igor (1); bei Karl Marx: Laura, Jenny.
Ihr Lieblingsgericht: Rentierfleisch (7), Fischsuppe (2), Pelmeni (2), alle Tschuktschenspeisen
(4), Bratkartoffeln (1), Kartoffelbrei (1), Kartoffeln mit Spiegelei (1),
eingelegte Pilze (1), Eier in Mayonnaise (1); bei Karl Marx: Fisch.
Ihre Lieblingsmaxime: Einer für alle, alle für einen! (5), Nicht glimmen,
sondern brennen (2), Dort sein, wo es schwierig ist! (2), Lieber weniger aber
besser! (2) Ein gestecktes Ziel niemals aufgeben! (2)
Gesagt - getan" (1), Nicht weichen! (1), Kein Blatt vor den Mund nehmen!
(1), Der Wahrheit ins Auge sehen! (1), Lernen, lernen und nochmals lernen! (1),
Nie auf der Stelle treten! (1), Vorwärts, immer nur vorwärts! (1); Bei Karl
Marx: Nicht Menschliches ist mir fremd.
Ihr Lieblingsmotto: Auch bei Sturm fest auf den Beinen stehen! (2) ,
Kämpfen, suchen, finden und nicht aufgeben! (2) Lerne, dich zu beherrschen!
(2), Hast du ein Werk begonnen, führe es tapfer zu Ende! (2), Keinen Schritt
zurück! (1), Nie auf der Stelle treten! (1), Verzweifle niemals! (1) Bei Karl
Marx: An allem ist zu zweifeln.
Sind diese zwanzig Antworten auch nicht repräsentativ für 14 000 Tschuktschen,
so sind sie doch ein interessantes Spiegelbild: ausschließlich russische
Lieblingsnamen... Blau die Farbe des Himmels und des offenen Meeres, die
Lieblingsfarbe im weiten, meist weißen Tschuktschenland!
Beeren sammeln - eine bei uns (leider) nahezu ausgestorbene
Lieblingsbeschäftigung! Als Lieblingsspeisen auch Eier und Kartoffeln -
Lebensmittel, die die Tschuktschen früher nicht einmal vom Hörensagen kannten.
Bemerkenswert auch, dass die jungen Tschuktschinnen
die Verse der einheimischen Lyrikerin Antonina Kymytwal
und die des russischen Poeten Alexander Puschkin gleichermaßen lieben."
Alphabetisierung mit Problemen: Bereits in den zwanziger Jahren wurde
intensiv daran gearbeitet, Schriftsprachen für die meisten indigenen Völker
der Sowjetunion
zu schaffen. Mancherorts wurde der Analphabetismus innerhalb
kurzer Zeit beträchtlich
verringert. Dann fiel auch das Bildungssystem dem Stalinismus zum Opfer. Ab
1937 mussten per Dekret alle Sprachen mit kyrillischem Alphabet geschrieben werden,
auch solche, deren Phonetik diesem
Alphabet nicht entsprach. Sprachwissenschaftler, die mit eigens den Sprachen angepasstenAlphabeten
gearbeitet hatten, wurden als Volksfeinde verhaftet. Ab 1957 konnten Lehrer bestraft werden,
wenn sie außerhalb des muttersprachlichen
Unterrichts an Schulen in der Sprache des
einheimischen Volkes redeten. Um 1970
wurde als einzige der 26
Minderheitensprachen
nur noch die Sprache der Nenzen
im Schulunterricht verwendet. - Auch das System der Internatsschulen -
gut
gedacht ! - hatte stark negative Konsequenzen. Ursprünglich dafürgedacht,
Nomadenkindern die Möglichkeit des Schulunterrichts zu bieten, wurde es nach
und nach leider auf alle Kinder angewendet, auch auf die sesshaften. Mit 16
Jahren kamen diese Kinder dann wie Fremde und ohne kulturelle Bindung an
ihr Volk zu ihren Familien zurück. Dieses System wird heute nicht mehr
praktiziert, aber der angerichtete Schaden ist groß; denn nicht mehr viele Tschuktschen
wollen den außerordentlich schweren Beruf des Rentierzüchters ausüben.
Kartoffeln auf
ewigem Frostboden (LESEPROBE aus
"Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Nachdem wir von Magadan
aus etwa zwanzig Kilometer mit dem Auto über kargen Tundraboden
geholpert sind, stehen wir plötzlich vor einem unübersehbar großen Feld:
Pflanzen mit kräftigen dunkelgrünen Blättern, hier und dort durchbricht eine
weiße oder hellviolette Blüte mit gelbem Kelch das tiefe Grün. Ein lieblicher
Anblick inmitten scheinbarer Trostlosigkeit. Ich erfreue mich daran, bis mich
Grigori Kumbadse darauf aufmerksam macht, dass es
sich bei den von mir so andächtig betrachteten Pflanzen um Kartoffeln handelt.
(Klein-)Laut erwidere ich, dass die Kartoffel immerhin eine alte Kulturpflanze
ist und auch einmal als Zierpflanze verbreitet war. Insgeheim nehme ich mir
vor, nie mehr achtlos vorüberzugehen an den Kornblumen am Feldrain, den
Gänseblümchen auf der Wiese, den Butterblumen am Wegesrand...
Mark Tatarstschanow, Wissenschaftler des
Landwirtschaftlichen Forschungsinstituts in Ola, hat
indes einen Kartoffelstrauß für mich gepflückt und überreicht ihn mir mit
Handkuss und einer Geste, als würde er mir im Smoking langstielige Rosen
verehren. Alle lachen, und ich darf das nördliche Nachtschattengewächs auch
weiterhin schön finden. Und wie schön, denn Mark Tatarstschanow
lässt gleich eine Kartoffellektion folgen: `In Ihrem Land können Sie ja dieser
Pflanze auf Schritt und Tritt begegnen. Aber bei uns? Noch bis vor etwa
fünfzehn Jahren hielt man den Anbau der Kartoffel im Magadaner
Gebiet für unmöglich. Die angestammten Völker des
hohen Nordens kannten dieses Nahrungsmittel überhaupt nicht, und wir
`Zugereisten´ mussten uns mit eingeführten Trockenkartoffeln begnügen. Nun hat
unser Institut nach vielen Probejahren Sorten entwickelt, die in der kurzen
Vegetationsperiode - von Juni bis maximal 20. September - reifen. Das hier ist
ein Versuchsfeld. Sie sehen, dass alle paar Meter eine andere Sorte gepflanzt
ist. Bis jetzt kann nur 0,01 Prozent des Magadaner Gebietes
landwirtschaftlich genutzt werden. Trotzdem decken wir bereits 35 Prozent des
Kartoffel- und 80 Prozent des Kohlbedarfs unserer Bevölkerung.´
Wir wünschen Mark Tatarstschanow, dass auch der
Norden bald ausreichend Kartoffeln haben möge, `die wichtigste Frucht für hoch
und niedrig, reich und arm (`Der Ratgeber´, 1907)
Als wir zum landwirtschaftlichen Ausbildungssowchos
`Technikum´ weiterfahren, denke ich darüber nach, was eigentlich `Norden´ ist.
Kaukasus, Mittelasien..., da weißt du, woran du bist. Aber Norden? Gar hoher
Norden?
Zu Beginn seiner Erschließung betrachtete man den Norden lediglich als eine
Himmelsrichtung, die besonders dicke Kleidung erfordert. doch schon bald löste
der Begriff Norden hitzige wissenschaftliche Diskussionen aus. Die erste Lehre,
dass der Norden nicht nur schlechthin geographisch Norden ist, erteilte der
ewige Frostboden den Menschen - indem er im Sommer, wenn der Boden ein bis zwei
Meter auftaut, die Straßen regelrecht in die Erde versinken und die
konventionell gebauten Gebäude wie Kartenhäuser zusammenstürzen ließ. Wirtschaftsgeographen machten sich damals daran, eine
Definition für `Norden´ zu suchen. Nachdem sie sich die Köpfe heiß geredet
hatten, bezeichneten sie als Norden die Ödflächen nördlich und östlich der wirtschaftlich
entwickelten Gebiete. Doch da waren inzwischen schon weitere Flächen längst
kein Ödland mehr...
Eine neue Definition musste her. Man einigte sich, solche Regionen Norden zu
nennen, deren Klima weder Weizen, Roggen noch Hafer gedeihen lässt. Doch da
experimentierte man im Kolymagebiet bereits mit
besonderen Hafersorten, und auf der Tschuktschen-Halbinsel
gedieh schon der erste nördliche Kohl.
Indem die Menschen unentwegt Unmögliches möglich machten, wurde Definition um
Definition verworfen. Mir scheint die Überlegung meines Journalistenkollegen Murad Adshijew richtig zu sein.
`Als Norden´, schreibt er, `ist jene Region anzusehen, wo für Menschen und
Maschinen ein höherer Energieaufwand erforderlich ist als in anderen
Landesteilen. Um leben zu können, verbrauchen die Menschen Energie. Je
kalorienreicher die Nahrung, desto mehr Energie: Treibstoff und Elektroenergie.
Geht man von Moskau aus langsam nach Norden und vergleicht dabei die einzelnen
Gebiete miteinander, so kann man eine Grenze ermitteln, hinter der ein
deutlichrer Anstieg des Energiebedarfs von Mensch und Maschine zu erkennen ist.
Ab hier also beginnt der Norden, beginnen jene eigenartigen und ungewohnten
Gebiete, in denen alles anders ist.´
Die sechsundzwanzig angestammten Völkerschaften des
hohen Nordens - die Alëuten, Chanten,
Dolganen, Enzen, Eskimos, Ewenen,
Ewenken, Itelmenen,
Jakuten, Jukagiren, Keten, Korjaken, Mansen, Nanaier, Negidalen, Nenzen, Niwchen, Nganassanen, Oroken, Orotschen, Saamen, Selkupen, Tofalaren,
Tschuktschen, Tschuwanzen, Ultschen
- wissen das schon Jahrhunderte lang, denn ihre Nahrung bestand eh und je aus
großen Mengen Fleisch und Fett.
Im landwirtschaftlichen Ausbildungssowchos
`Technikum´ betreten wir gerade das Zimmer des Direktors, um über Funk
mitzuhören, dass Rentiere und Rentierzüchter wohlauf seien, dass es keine
besonderen Vorkommnisse gäbe, aber - dass man sich über neue Filme freuen
würde. `Schickt was Lustiges und was mit Liebeskummer´, sagt eine fröhliche
Jungenstimme.
Eintausendeinhundert Lehrlinge erlernen im Ausbildungssowchos
`Technikum´ den Beruf des Rentierzüchters, Zootechnikers, Veterinärs oder
landwirtschaftlichen Buchhalters - zweieinhalb Jahre bei 10-Klassen-Abschluss.
Wir fragen zehn Lehrlinge, warum sie den außerordentlich anstrengenden Beruf
des Rentierzüchters gewählt haben. Hier ihre Antworten:
`Ich komme aus der Tundra und möchte dahin zurück.´
Mein Vater ist es, meine vier Brüder sind es, ich möchte es auch werden.´
`In unserer Schule hat mich der Komsomol dafür geworben.´
`Rentierzüchter werden gebraucht.´
`Vater und Mutter zuliebe. Sie wollen unbedingt, dass ich in die Tundra
zurückkehre, damit die Familie wieder zusammen ist.´
`Mich hat die Zeitung geworben. Rentierzüchter ist heute ein Mangelberuf.´
`Ich trau´s mir zu.´
`Meine Freundin wird Tierärztin. Wir wollen zusammen in eine
Rentierzüchterbrigade gehen.´
`Aus Einsicht in die Notwendigkeit.´
`Es können doch nicht alle Tschuktschen Lehrer, Ärzte, Piloten oder (Jewgeni
schmunzelt) Journalisten werden.´"
Als ich
Juri
Rytchëu, den
ersten Schriftsteller der Tschuktschen 1983 in Leningrad besuchte, erzählte
er mir von seinem ersten Kartoffelbrei, dem ersten Biss in einen Apfel
und - seiner ersten Melone: "Es war 1948 in Leningrad. Auf meinen Streifzügen durch die Stadt geriet ich auch auf den Basar. Und da sah ich sie, eine Melone,
die ich aus dem Schulbuch kannte. Für mein letztes Geld kaufte ich mir eine und
schnitt von der grünen Oberfläche eine dünne Scheibe ab. Ich hatte etwas
Ungewöhnliches erwartet, einen zauberhaften, ungeahnten Geschmack, eine
besondere Zartheit, Süße, kurz ein wundervolles Aroma... Aber ich empfand gar
nichts... Die Melone schmeckte wie das gewöhnlichste Tundragras,
das an einem See oder am Ufer eines Baches bei uns zu Hause wuchs. Ärgerlich
trat ich gegen die Melone, die Frucht zersprang in zwei Teile: rot und feucht
mit komischen schwarzen Dingern... Ich schmiss sie in einen Mülleimer und drehte mich nach dem komischen Ding nicht mal mehr um."
Endlich in Tschukotkas Hauptstadt (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des
Polarkreises")
"Hurra, wir sind im Autonomen Bezirk
der Tschuktschen. Hurra - was heißt hurra? Zu Hause hatte ich geglaubt, ich
würde bei der Ankunft vor Freude bis ans tschuktschische
Himmelsblau springen. Aber ich tu´s nicht. Ich kann
es wohl nicht fassen, nach fast dreißig sehnsuchtsvollen Jahren wirklich und
wahrhaftig auf Tschukotka zu sein. Ganz sachlich
nehme ich den Flugplatz zur Kenntnis, auf dem wir von Magadan
aus mit erster (unvorhergesehener) Zwischenlandung in Jenissejsk
und zweitem (vorgesehenem) Zwischenaufenthalt in Krasnojarsk mit einer IL 18
gelandet sind. Unbeeindruckt besteige ich dann auch ein Schiff, das uns über
den Fluss Anadyr in die Stadt Anadyr bringen wird. Raissa
Netschajewa, Dolmetscherin aus Moskau, weiß seit mehr
als zehn Jahren von meinem Tschukotka-Traum. Jetzt
schaut sie mich immer wieder an - auch sie enttäuscht, dass ich keinen
Freudentanz aufführe.
Ist der Mensch endlich am Ziel seiner Wünsche, reicht die Kraft zu
überschäumender Freude wohl nicht mehr aus.
Da hilft das Schicksal meinen scheinbar abgestumpften Gefühlen nach. Ich
stolpere beim Aussteigen über eine Schiffsplanke und - liege Tschukotka, meinem Tschukotka, zu
Füßen.


Auf Tschukotka: Text-Reporterin Gisela Reller;
Dolmetscherin Raissa Netschajewa aus Moskau, Bild-Reporter Detlev Steinberg
- vorgestellt in der Zeitung Советсҝая
Чукотка (Sowjetisches Tschukotka) vom
25. August 1980.
Im Hotel erhalten die `weitgereisten Mädchen´ ein Appartement (Wohnzimmer und
Schlafzimmer, Bad und Toilette). Müden Auges, aber leichten Herzens verzichte
ich darauf, das Gepäck auszupacken, um Tschukotkas
Hauptstadt Anadyr, erst einmal für mich allein zu erobern.
Augenfällig, dass du dich hier jenseits der Baumgrenze befindest. Weit und
breit weder Baum noch Strauch, nur kleine Vorgärten, wenn diese Bezeichnung für
das bisschen Grün mit den winzigen Margeritenköpfen, die eher Kamillenblüten
ähneln, gestattet, ist. Sommersaubere Straßen mit Omnibusverkehr, vielen Lastkraftwagen,
wenigen Pkws.
Anadyr hat fünfzehntausend Einwohner, die einunddreißig Nationalitäten
angehören. Da lässt es sich denken, dass hier keiner neugierig auf den anderen
blickt, mag er nun Hosen aus Rentierfell tragen oder einen seidenen Rock, eine Kuchljanka oder einen schwarzen Anzug.
Es ist gerade 12 Uhr mittags, keiner jedoch, der gemütlich schlendert, alle
streben eilig einem bestimmten Ziele zu. Man scheint es eilig zu haben in
Anadyr.
Ich entdecke zwei Häuser mit Balkon, einen Pionierpalast, das Parteikomitee Tschukotkas, ein Filmtheater, eine Buchhandlung, ein
Heimatkundemuseum. Dann schaue ich mich in einem großen Lebensmittelgeschäft
um. Außer bei frischem Obst und Gemüse (statt dessen viele in- und ausländische
Konserven) wüsste ich im Augenblick nicht zu sagen, welche Lebens- und
Genussmittel sowohl für einen alltäglich gedeckten als auch für einen festlich
gedeckten Tisch nicht ausreichend vorhanden wären. Frische Milch und Eier, so
sagt mir eine Verkäuferin, seien Zuteilungsware, aber, so fügt sie hinzu, dass
sei hier im hohen Norden wohl nicht so erstaunlich. Dafür gäbe es Milch und
Eipulver in ausreichender Menge. Und ich entdecke viele Fischkonserven, für die
nicht nur die Moskauer durchaus längere Anstehzeiten in Kauf nehmen würden: Krabben,
Dorschleber, Thunfisch...
Die Sauberkeit des Ladens ist - so will mir scheinen - kaum zu übertreffen.
`Nordehre´, Ljuba aus Leningrad lacht, `wenn wir schon nichts gegen das Klima
ausrichten können, so muss alles Drumherum lecker sein.´ Übrigens ist eine jede
Ware trotz des weiten Transportweges für den gleichen Preis zu haben wie in
allen anderen sowjetischen Landesteilen (was im arktischen Alaska oder in
Kanada durchaus nicht selbstverständlich ist).
Als ich am Fluss Anadyr ein Denkmal betrachte, sagt eine junge Frau zu mir:
`Hier an dieser Stelle, wo jetzt moderne Steinhäuser stehen, habe ich als Kind
noch Pilze gesucht.´ Swetlana ist Ukrainerin, kam 1965 mit ihren Eltern hierher
(sie sind inzwischen als Rentner nach Minsk zurückgekehrt) und blieb, mit einem
Tschuktschen verheiratet, in Anadyr. Swetlana erzählt mir auch, was es mit
diesem Denkmal auf sich hat: Es erinnert an die Mitglieder des Ersten
Revolutionskomitees von Tschukotka. Im Februar 1920
waren alle elf Mitglieder von Koltschakleuten
erschossen worden, darunter ein Russe (Matrose der Baltischen Flotte), ein Tschuwanze, ein Tatar (Soldaten der Roten Armee)...
Anadyr, so hatte ich zu Hause meinen Aufzeichnungen entnommen, ist über
dreihundert Jahre alt. Es wurde begründet von dem seefahrenden Kosaken Semjon Deshnjew, der hier 1652 die erste Hütte errichtet hatte. Er
nannte diesen Ort Nowomarinsk. Im April 1655 schrieb
der längst Totgeglaubte an den Woiwoden
von Jakutsk, in dessen Namen er im Land der
Tschuktschen Tribute eintreiben sollte: `Wir fuhren von der Kowyma
[Kolyma] nach unserem Lager, und der Handelsmann Fedot
Alexejew [Popow] wurde in einem Handgemenge mit
Tschuktschen verwundet, und Fedot und ich, Semeika, wurde auf dem Meer auseinandergetrieben und vor
der Mündung an einem Küstenvorsprung jenseits des Anadyr an Land geworfen...
Das große Kap habe ich, Semeika, mit meinem Gefährten
kennengelernt...´
Mit seiner unfreiwilligen Driftfahrt hatte Deshnjew
den nordöstlichsten Punkt des asiatischen Kontinents umrundet (heute: Kap Deshnjew) und bewiesen, dass es dort eine Meeresstraße gibt.
Die Bezahlung seiner Dienste erreichte Deshnjew erst
nach sieben Jahren durch ein Bittgesuch an den Zaren. Er erhielt
einhundertvierundsechzig Rubel und vierundachtzig Kopeken sowie
siebenundneunzig Arschin [altes russisches Längenmaß,
1 Arschin = 71,2 Zentimeter] Tuch von kirschroter
und grüner Farbe und wurde in den Atamanstand
erhoben. Doch sein Bericht lag ungelesen im
Stadtarchiv von Jakutsk, und niemand erfuhr etwas von
einer Meeresstraße zwischen der Tschuktschen-Halbinsel
und Alaska. Erst der deutsche Historiker Gerhard Friedrich Müller - Teilnehmer
der zweiten Bering-Expedition - fand ihn 1736, fast einhundert Jahre später.
Der dänische Seeoffizier Vitus Bering war also nur der Wiederentdecker
der nach ihm benannten Meeresstraße.
An der Stelle des russischen Nowomarinsk entstand
dann 1889 Anadyr, heute eine Stadt, die sich sehen lassen kann.

Blick auf Tschukotkas Hauptstadt Anadyr
(1981).
Foto aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
Als ich endlich im Bett liege, ist es schon Mitternacht, bei uns zu Hause isst
man bereits Mittag. Um einschlafen zu können, zähle ich keine Schafe, auch
keine Rentiere, sondern Möbelstücke... Ich versuche mir auszurechnen, wie viel
Schränke, Sessel, Liegen... von weither gebracht werden müssen, damit es die
Menschen hier wohnlich haben. Bei 990 000 Stuhlbeinen endlich ist mein durch
den großen Zeitunterschied völlig durcheinandergeratener Biorhythmus
überlistet..."
Vater der
sibirischen Geschichts-schreibung,
Gerhard
Friedrich Müller (auch Fjodor Iwanowitsch Miller,
1705 bis 1783), war ein deutscher Historiker, Geograph,
Russlandforscher und Forschungsreisender. Müller besuchte zunächst das
Friedrichs-Gymnasium
Herford, an dem sein Vater Rektor
war. Er studierte an der
Universität
Rinteln und der
Universität
Leipzig
Philosophie und
Geschichte. 1725 ging er nach
Sankt
Petersburg und war dort an der
1724/25 gegründeten
Russischen Akademie der Wissenschaften als Geschichts- und Lateinlehrer tätig. Im Alter von 25
Jahren wurde er 1730 zum ordentlichen Professor an der Akademie der
Wissenschaften ernannt, wie zuvor 1725 nur sein Landsmann, der
Universalgelehrte
Johann Peter Kohl. Im Forschungsauftrag der Russischen Akademie bereiste er
Holland und
England. Nach seiner Rückkehr wurde er zusammen mit
Johann Georg Gmelin
von der
Zarin
Anna Iwanowna mit der Leitung der historischen und ethnographischen
Arbeitsgruppe der
Zweiten
Kamtschatkaexpedition (1733 bis
1743) beauftragt. 1736 fand Professor Müller im Archiv der Jakutsker
Kanzlei Beweise, dass nicht
Vitus Bering 1728 als erster die
Beringstraße durchfuhr, sondern schon Jahre zuvor der russische
Pelztierhändler
Semjon Deshnjew (1605 bis 1673).
Zwei
Menschenschicksale (LESEPROBE aus
"Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Mehr als
zehntausend Kilometer vom Schauplatz der revolutionären Ereignisse entfernt,
dazumal winters nahezu unerreichbar, ging auf Tschukotka
noch mehr als ein Jahrzehnt lang vieles im alten Schritt und Tritt. Und so
musst du in Anadyr nicht mühevoll Ausschau nach Menschen halten, die die ersten
nachrevolutionären Jahre noch selbst miterlebt haben.
Da ist der Tschuktsche Iwtek
Berjoskin, Lehrer am Pädagogischen Institut von
Anadyr. Er wäre als Fünfzehnjähriger fast verhungert.
`Das war 1934´, erzählt er uns. ´Ich wurde in der Familie eines Amguemer, eines Rentier-Tschuktschen,
geboren. Wir waren neun Geschwister und besaßen zweihundert Rentiere. Das ist
sehr wenig, wenn man bedenkt, dass wir Tag für Tag von Rentierfleisch lebten
und dass sich elf Menschen von Kopf bis Fuß in Rentierfell kleideten. Es war
ein unvorstellbar schweres Leben. Täglich waren wir Dutzende Kilometer auf
Wanderschaft, Vater und die älteren Brüder oft Tag und Nacht ohne Schlaf - die
Rentiere durften ja keine Minute aus den Augen gelassen werden. Und dann
geschah 1934 ein Wetterdrama. Sozusagen über Nacht wurden wir - wie auch viele
andere Rentierzüchterfamilien - die ganze Herde los.
Damals gab es noch keine Kolchose, mit denen die heutigen Rentierhirten von der
Tundra aus per Funk verbunden sind. Es gab keine Flugzeuge oder Hubschrauber,
die bei einem Unglück heute sofort zur Stelle sind. Damals waren die Rentier-Tschuktschen in der Tundra genauso auf sich selbst
gestellt wie die Küsten-Tschuktschen oder Eskimos,
wenn sie auf einer Eisscholle ins offene Meer hinausgetrieben wurden.
`Wir kauten auf unserem düsteren Hungermarsch Seehundriemen, brieten die Felle
unserer Jaranga, ich aß den halben Ärmel meiner Kuchljanka auf... Nach Wochen endlich trafen Mutter und wir
Kinder mehr tot als lebendig im eben gegründeten Kolchos `Heller Weg´ ein.
Vater hatten wir unterwegs begraben.´
Ende 1973 spielte sich auf der Tschuktschen-Halbinsel
ein ähnliches Wetterdrama ab. Doch die neue Zeit ließ keinen Menschen mehr
Hungers sterben... Ein Zyklon, verbunden mit starken Regengüssen, hatte die
Tundra bei plus fünf Grad in einen Sumpf verwandelt. Ein nachfolgender
Kälteeinbruch überzog etwa die Hälfte der Halbinsel mit einem Eispanzer. Binnen
weniger Stunden wurde das Rentiermoos für dreihundertsiebzigtausend Rentiere
unzugänglich. Doch neununddreißig Jahre später, nachdem der schon nach der
Revolution geborene kleine Tschuktschenjunge Iwtek seinen Vater verhungern sah, ging es so
weiter: Flugzeuge, Hubschrauber, von Traktoren gezogene Schlittenzüge und
Hundegespanne machten sich mit Medikamenten, Mischfutter und Robbenfett auf den
Weg, die Tiere der zwanzig Rentierkolchosen vor dem sicheren Tod zu bewahren.
Und eilig gebildete Gruppen von Zootechnikern und Kolchosmitgliedern suchten
fieberhaft nach eisfreien Weideflächen. Mit vereinter Kraft fand man sie an den
Nordhängen erloschener Vulkane."
Letzte Nachricht:
Als ich diese Zeilen schreibe (am
24.05.2013)
erschütterte im Ochotskischen Meer ein Erdbeben
der Stärke 8,2 den russischen Fernen Osten. Die Erdstöße waren auf dem ganzen
Territorium des Fernen Ostens, Sibiriens und sogar in Moskau zu spüren.
Weiter: Zwei Menschenschicksale (LESEPROBE
aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Da ist die Tschuktschien Lina Tynel, die wir
im Parteikomitee kennenlernen.
Lina Tynel ist Vorsitzende des Exekutivkomitees des
Autonomen Bezirks der Tschuktschen, Deputierte des Obersten Sowjets und
Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR. Den Namen Tynel (vor der Oktoberrevolution war dies ihr Vor- und
Zuname zugleich) gab ihr der Vater, weil sie zur Welt kam, als die Weidefläche
gerade von einem todbringenden Eispanzer überzogen war. Der Vater, Rentiernomade,
starb, als Tynel noch ein kleines Mädchen war. Und so
wurde die Halbwaise "Vereister Schnee" von russischen Erziehern im
Schulinternat erzogen, danach von russischen Lehrern zum Studium nach Leningrad
delegiert, wo sie am Herzen-Institut von russischen
Pädagogen den Vornamen Lina bekam und als Lehrerin ausgebildet wurde. Nach
Beendigung des Studiums arbeitete sie zuerst an einer allgemeinbildenden Schule
für einheimische Kinder, dann fast ein Jahrzehnt lang beim Magadaner
Verlag als Redakteur für Bücher in der Tschuktschensprache.
Lina Tynel spricht über den Tod des Vaters und über
ihr erbärmliches Leben in der Tundra sehr stockend, sehr leise. Sie, die heute
`mächtigste Tschuktschin´, unterdrückt nicht ihre
Tränen. `Wissen sie´, sagte sie entschuldigend, `in den Köpfen unserer
Generation ist das Alte unauslöschlich geblieben. Erst die Kinder unserer
Kinder werden neue Menschen sein - glücklichere, reichere... Hoffentlich nicht
gleichzeitig auch ärmere. Eine meiner Sogen ist, dass Tschuktschen und Eskimos
einmal ihre Muttersprache vergessen könnten. Eine Gefahr, der jedes Volk
ausgesetzt ist, wenn es so stark in der Minderheit ist.´
Lina Tynel, fünfzigjährig, ist Witwe. Ihr Mann starb
an Tuberkulose, einst Krankheitsgeißel Nummer eins bei Tschuktschen und
Eskimos. Heute ist die Tuberkulose hier ausgerottet.
Und Lina Tynel ist Mutter erwachsener Kinder. Die
beiden Töchter fühlen sich als künftige Pädagoginnen mehr der Zukunft
verpflichtet, der Sohn als zukünftiger Historiker mehr der Vergangenheit.
`Wie dankbar bin ich, dass die Sowjetmacht zu uns gekommen ist. Was wäre sonst
aus meinen drei Kindern geworden? Früher starben ja die meisten, kaum dass sie
das Sonnenlicht erblickt hatten´, sagt sie."
Buch
heißt
auf Tschuktschisch
kniky:
"Solange ich zurückdenken kann, gab es in unserer
Jaranga Bücher. Anfangs war es eine ziemlich zerfledderte
Bibel in russischer Sprache... Sie hatte meinem Großvater, dem großen Schamanen
Mletkin, gehört... Dann tauchten bei meiner älteren
Tante Lehrbücher auf, und das Erstaunlichste war, darunter gab es auch Bücher
in tschuktschischer Sprache. Einige waren mit
lateinischen Buchstaben gedruckt und die erste Fibel hieß CELGYRALEKAL, was
`Rotes Lesebuch´ bedeutet. Diese Fibel war von den ersten Studenten des
Instituts der Völker des Nordens in Leningrad
zusammengestellt worden, unter ihnen auch Landsleute von uns,
Uëlener... Keine einzige Erfindung der Tangitan
(der Fremden) konnte meine Neugier so stark erwecken wie das Buch, das für mich
ein Zauberbrunnen war... In den ersten Klassen wurde der Unterricht vor allem
in Tschuktschisch durchgeführt. Ich beherrschte die Schrift ziemlich schnell.
Allerdings gab es nur wenige Bücher in meiner Muttersprache. Ich erinnere mich bis heute ganz genau an sie. Das war vor allem die prächtige Ausgabe der
Verfassung
der UdSSR im Taschenformat... Viele Wörter, die aussahen wie
tschuktschische, waren in Wirklichkeit russische,
tschuktschisch waren nur die Suffixe, die Endungen. Die
tschuktschischen Wörter sahen sehr merkwürdig aus... Dafür
las ich mit großem Vergnügen und nicht nur ein Mal den Band mit
tschuktschischen Nomadenmärchen. Für mich war das wie ein
Wunder - meine Muttersprache erklang von den Papierseiten.... Immer öfter
richtete ich meinen hungrigen Blick auf die Reihen der eng aneinander stehenden
Bücher in der Schulbibliothek und in den Regalen der Kantine auf der
Polarstation. Aber das Russische beherrschte ich noch nicht, obwohl die
Buchstaben die gleichen waren, die auch in der tschuktschischen
Schrift benutzt wurden.... Das erste, was ich Russisch lernte, waren
Schimpfwörter... Außerdem spielten wir häufig "Russen", vor allem
"betrunkene Russen"... Wann ich endlich perfekt Russisch gelernt
habe, sodass ich Bücher lesen konnten, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war
das im Alter von neun, zehn Jahren... Der Lesehunger verschlang fast meine
gesamte Freizeit. Ich begann, mich vor meinen
häuslichen Pflichten zu drücken. Anstatt die Hunde zu füttern oder Treibholz am Strand
und Wurzeln auf den
Hügeln für das Feuer zu sammeln, aus unserem Bach Wasser zu holen und die
Hausaufgaben rechtzeitig zu erledigen,
ging ich zu meinem Versteck und
versank... in eine andere Welt... Dann kam die Zeit, wo ich mich für die
Verfasser interessierte. Anfangs war ich fest davon überzeugt,
dass alle Schriftsteller zu einer ausgestorbenen Gattung Mensch gehörten... Mit einem
gewissen
Misstrauen fasste ich die Nachricht auf, dass viele Schriftsteller
noch am
Leben waren und immer neue Bücher schrieben. Meine Einbildungskraft reichte
nicht aus, um mir wenigstens annähernd die Gestalt eines Romanschöpfers
vorzustellen..."
Juri
Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in:
Alphabet meines Lebens, 2010
Sorgen..., nichts
als Sorgen? (LESEPROBE aus
"Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Bevor wir weiter ins Tschuktschenland vordringen, empfängt uns Wjatscheslaw
Iwanowitsch Kobez, Erster Sekretär des
Tschuktschischen Bezirkskomitees des Magadaner
Gebietes zu einem Gespräch. Seine Nationalität ist Russe, seine eigentliche
Heimatstadt Moskau und seine Heimat, so sagt er, die ganze Sowjetunion. Sein
ewig gefrorenes Reich ist fast siebenmal so groß wie die DDR. Wie groß sind
seine Probleme?
Wjatscheslaw Iwanowitsch, ich bin ganz begeistert von Tschukotkas
Hauptstadt Anadyr - mit ihren modernen Steinhäusern, dem schönen Pionierpalast,
dem komfortablen Filmtheater, dem so geschmackvoll ausgestatteten Kulturklub,
von den Betonstraßen, den Grünflächen mit den, wenn auch kleinen weißen
Margeriten... Und all das auf ewigem Frost! Ich habe mir den `Rand der Welt´
anders vorgestellt.
So? Wie denn?
Irgendwie provisorischer...
Zehntausende Menschen kommen durchaus vorübergehend aus allen Gegenden der
Sowjetunion in den hohen Norden. Ein Teil jener Nordländer ist tatsächlich
nicht sehr daran interessiert, `für die Ewigkeit´ zu bauen, Grünanlagen zu
errichten, die Umwelt zu erhalten und - sauber zu halten.
Wir sind aber inzwischen einigen `Zugereisten´ begegnet, die sich hier seit
Jahrzehnten häuslich niedergelassen haben.
Ja, in den Städten, in Magadan, in Anadyr, in Pewek. In vielen Siedlungen sieht es aber nicht so rosig
aus.
Warum nicht?
Das Hauptproblem für den ganzen Nordosten ist der Wohnungsbau. Wir brauchen
nicht alle paar Jahre neue Anfänger hier, sondern Menschen, die mit
komplizierter Arbeit und enormen Kältegraden bestens vertraut sind. Leider sind
aber im letzten Planjahrfünft vierzig Prozent weniger Kader als im gleichlangen
vorangegangenen Zeitraum ins Magadaner Gebiet
gekommen. Hochqualifizierte Arbeiter, die jahrzehntelang bei uns bleiben
sollen, wollen in Siedlungen mit städtischem Komfort wohnen. Und sie haben ein
Recht darauf, obwohl jedes in unserem Landstrich gebaute Haus fünfmal teurer
ist als in Mittelrussland.
Wer sich entschließt, am Nördlichen Polarkreis zu leben, sollte der nicht
auf den einen oder anderen Komfort verzichten können?
Auf Luxus ja, auf Komfort nicht. Menschen, die sich hier ansiedeln, reisen doch
mit ihren Familien an oder gründen hier Familien, Kinder kommen. Sollen sie
benachteiligt sein?
Was ist für Sie Luxus, was Komfort?
Komfort? Nun, das heißt Strom, moderne Heizung, schöne Möbel, Kühlschrank,
Fernsehanschluss erst einmal, dann Fernseher... Und Luxus? Das wäre zum
Beispiel ein Farbfernseher - sozusagen als Zweitgerät. Sollen sie zusätzlich
auch noch in großer Zahl hergebracht werden? Über den Nördlichen Seeweg? Auf
dem Luftweg? Bei Frost über die vereisten Flüsse? Auf diesen Wegen muss
massenweise Lebensnotwendiges zu uns in die Arktis gebracht werden - angefangen
von Trockenmilch... Besonders problematisch, dass es ausgerechnet hier im Norden
- wo die Menschen über hundert Prozent mehr verdienen als in klimatisch
günstigeren Gegenden - natürlich niemanden gibt, der nicht auch genug Geld für
Luxusgegenstände hätte.
Wjatscheslaw Iwanowitsch, welche Sorgen haben Sie mit Tschukotka?
Uns fehlen stabile Autostraßen; wir brauchen mehr, viel mehr Fahrzeuge in
`nördlicher Ausführung´, also Motorschlitten, Luftkissenfahrzeuge; es müssen komfortable
fahrbare Rentierzüchterhäuschen mit individueller Energieversorgung konstruiert
werden - statt der Felljarangas mit den offenen
Feuerstellen. Erforderlich ist die sofortige Einführung jeder für den Norden
geeigneten neuen Errungenschaft von Wissenschaft und Technik. Beispielsweise
bringt die Freisetzung eines einzigen Facharbeiters im Bergbau durch Einführung
neuer Technik einen volkswirtschaftlichen Nutzen von etwa neunzehntausend Rubeln
jährlich!
Es gibt doch hochleistungsfähige Geländewagen, mit denen man durch die
sumpfige Tundra, durch flache Seen, über steinige Hügel sicher fahren kann.
Die schweren Raupenfahrzeuge, von denen Sie so angetan scheinen, entsprechen
sehr gut unseren Bodenbedingungen, aber sie zerstören die Vegetationsdecke der
Tundra erbarmungslos. Die Moose und Flechten - die einzige Nahrung der Rentiere
- wachsen jährlich einen einzigen Millimeter. Verstehen Sie, einen Millimeter.
Unsere Tundra - und mag sie auch noch so groß sein - ist jedoch im wesentlichen
erschlossen. Es gibt so gut wie keine freien Weideflächen mehr. Die vorhandenen
müssen gehegt und gepflegt werden! In Alaska beispielsweise zählte man noch vor
etwa dreißig Jahren eine Million Rentiere. Der Raubbau an den Weiden führte
dazu, dass heute nur noch etwa fünfzigtausend Tiere Nahrung finden. Eine
glückliche Zukunft der Polargebiete ist aber ohne Rentier, das dem Menschen
Fleisch, Milch, Leder liefert und auch als Last- und Reittier dient, unmöglich!
Zurück also zum Hundeschlitten?
Der Hundeschlitten ist ein über Jahrhunderte bewährtes Transportfahrzeug.
Jedenfalls kommt es darauf an, eine vernünftige Verbindung zu finden zwischen
technischen Neuerungen und althergebrachten Lebensformen.
Haben sie Nachwuchssorgen bei der Rentierzucht?
Auch das. Viele junge Tschuktschen, Eskimos, Ewenen, Ewenken, Tschuwanzen, Jukagiren wollen sich in anderen als den traditionellen
Wirtschaftsbereichen beweisen. Und es werden ihnen - selbstverständlich zu
Recht - alle Bildungsmöglichkeiten gegeben. Andererseits wird die einheimische
Bevölkerung unbedingt in diesem uralten, unsagbar komplizierten
Wirtschaftszweig, der Rentierzucht gebraucht.
Früher wurden die `Geheimnisse´ der Rentierzucht von Generation zu Generation
sorgsam überliefert: wie man einen Schlitten baut und ein junges Ren zureitet,
wie man eine Raststelle für die Herde wählt und die Hunde anlernt. Heute muss
ein Rentierzüchter aber auch noch verstehen, ein Funkgerät zu bedienen, ein
Geländefahrzeug zu lenken und mit der Impfkanüle umzugehen. Doch verlieren
viele Jugendliche, die unter den Bedingungen des Internats erzogen werden, das
Interesse an den traditionellen Berufen. Deshalb wurden schon an vielen Schulen
Zirkel für Pelztierzüchter und Zirkel für die Anfertigung von Kleidungsstücken
aus Fellen eingerichtet. In Prowidenija gibt es eine
Berufsschule, an der Fahrer für Traktoren und geländegängige Fahrzeuge sowie
Funker ausgebildet werden, in Ola haben Sie den
landwirtschaftlichen Sowchos ja selbst besucht.
Wjatscheslaw Iwanowitsch, welche Freuden haben Sie mit Tschukotka?
Unsere Geologen entdecken Bodenschatz um Bodenschatz, kürzlich erst bei Anadyr
Erdöl und Erdgas; wir lernen, die vielen heißen Quellen zu nutzen, so dass wir
schon einheimische Vitamine - grüne Gurken, Tomaten, Radieschen; Eier - zu uns
nehmen können; wir decken einen Teil unseres Kartoffelbedarfs und
Kohlverbrauchs von Feldern auf ewigem Frostboden; Hunderte Kühe haben sich bei
uns im letzten Jahrzehnt akklimatisiert, in vielen Kindergärten und
Krankenhäusern gibt es schon frische Milch. Für all die Waren, die wir selbst
produzieren, können andere Güter zu uns transportiert werden. Es klappt immer
besser mit der Schichtarbeit der Rentierzüchter im Zwanzigtagerhythmus, wir
haben nur noch fünf Prozent echte Nomaden; ein ganz neuer Wirtschaftszweig ist
die Pelztierzucht, besonders geeignet für die einheimischen Frauen, die ja
heute durchaus nicht mehr unbedingt ihre Männer in die Tundra begleiten; na,
und dass `meine Margeriten´ blühen... Den Samen hatte ich im Gepäck aus Moskau
als `Antrittsgeschenk´ mitgebracht; die Erde musste allerdings aus Wladiwostok
eingeflogen werden.
Sie haben also nicht nur Sorgen mit Tschukotka?
Wo denken Sie hin? Innerhalb von fünf Jahrzehnten hat Tschukotka
einen Weg zurückgelegt, der vergangene tschuktschische
Jahrtausende zu einem Schritt werden lässt. Aber wir hier oben `am Rande der
Welt´ müssen ungeduldig sein; denn die so unvorstellbar grimmigen Schneestürme,
die unbeschreiblich eisige Kälte, die rauben uns unerbittlich viel produktive
Zeit. ´
Auf dem Weg vom Parteikomitee zum Hotel betrachte ich die `Vorgärten´ mit ganz
anderen Augen: viel größer erscheinen mir jetzt die weißen Blütenköpfe, viel
frischer das Grün der Stängel und Blätter."
Ein
Witz aus Tschukotka,
erzählt vom damaligen Ersten Sekretär des
Bezirksparteikomitees: Anfrage an den Sender Jerewan: `Was ist eine Sprotte?´
- Antwort: `Ein Wal, der im Kommunismus angekommen ist.´
Wal in Sicht (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des
Polarkreises")
"Auf der Tschuktschen-Halbinsel von Ort zu Ort zu gelangen, das
erfordert schon ein gerüttelt Maß an Organisationstalent, Wetterglück und
Wagemut. Organisationsgenie Anatoli Fjodorowitsch Frolow – Persönlicher Referent des Ersten Sekretärs des
Bezirksparteikomitees Tschukotkas – setzt eines Tages
unseren abenteuerlichen Transportmitteln das i-Tüpfelchen auf. Gelassen wie
immer sagt er: `Um nach Kap Lorino – eurem nächsten
Reiseziel – zu gelangen, müssen wir entweder Stunden um Stunden mit einem
Fischkutter auf See zubringen oder in einem Geländefahrzeug über Geröll und
durch Sumpf quer durch die Tundra fahren. Entscheidet euch!
Nach heftiger Debatte sind wir für den Landweg, da er wenigsten eins, die
Gefahr des Ertrinkens, ausschließt. Da aber hat Anatoli Frolow,
im weiteren Verlauf des Buches liebevoll Tolja
genannt, eine ganz neue Idee. `Kinder´, so sagt er, `lasst mich mal
telefonieren.´
Das Ergebnis seines Anrufs: Heute Abend sticht der Walfänger `Swjosdny´ in See. Sein Freund, der Kapitän (jedermann auf Tschukotka ist Toljas Freund, und
er selbst ist jedermanns Freund auf Tschukotka), ist
bereit, uns an Bord zu nehmen. Nach Art des hohen Nordens ist es kein Problem,
den achtzigsten Wal dieser Fangsaison statt nach Tschaplino
nach Kap Lorino zu bringen; die Eskimos von Tschaplino – über Funk befragt – haben nichts dagegen, sich
am einundachtzigsten Wal gütlich zu tun. `Womit wir´, so Tolja
glücklich, `sowohl ausgeschlafen als auch um ein tolles Erlebnis reicher,
gleichzeitig am Reiseziel wären.´
(…) Als einziger Kapitän hoch oben im Norden darf Leonard Maximowitsch
Wotrogow, wenn ein Wal bläst, auch heute noch
befehlen: Die Jagd beginnt! Wir – so beteuert uns Tolja
– werden die allerersten ausländischen Journalisten auf dem Walfänger `Swjosdny´ sein.
Nachts um zwei Uhr gehen wir in der Bucht Prowidenija
tatsächlich an Bord. Trotz der späten (oder frühen) Stunde empfängt uns Kapitän
Wotrogow mit seiner einunddreißig Mann starken
Besatzung so feierlich, als würde ein Admiral mit seinem Gefolge das Schiff
betreten.
Dann ganz schnell noch ein Häppchen und ein Schlückchen in der Kapitänskajüte,
und ab in die Koje – mit den eindringlichen Kapitänsworten im Ohr: „Fest
zuschließen, Mädchen*, Seeleute sind Seeleute.´
Anderntags in aller Herrgottsfrühe stehen wir (sofern wir nicht grün und
käsebleich über der Reling hängen) zusammen mit Kapitän Wotrogow
auf der Kommandobrücke des Walfängers. (…) Noch sind die Walgründe nicht
erreicht, und Leonard Maximowitsch ist bei mäßiger
Brise (Windstärke 4) zum Interview auf hoher See bereit.
Leonid Maximowitsch, die von Ihnen gejagten Wale
werden nur zu Orten gebracht, in denen Küsten-Tschuktschen
und Eskimos leben…
Ja, das sind neun Siedlungen an der Küste Tschukotkas.
Arbeiten auch Tschuktschen und Eskimos auf Ihrem Schiff?
Leider nicht, weil die gesamte Mannschaft unseres
Walfängers aus dem Heimathafen Wladiwostok stammen muss. Bedauerlicherweise gibt
es dort keine Vertreter dieser Völkerschaften, die die nötigen Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzen. Dass der örtlichen Bevölkerung der Walfang erlaubt ist,
heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie den Walfang auch selbst ausüben muss.
Unser Schiff ist sozusagen das `Dienstleistungsschiff´ für die Versorgung der örtlichen
Bevölkerung mit Walfleisch.
Sind die Küsten-Tschuktschen und Eskimos nicht daran
interessiert – eventuell mit ihren herkömmlichen Fangmethoden - , selbst Wale
zu jagen?
Es liegt ein Antrag der sowjetischen Eskimos vor, ihnen – mit ihren
althergebrachten – Methoden den Fang von Grönlandwalen zu gestatten, wie es den
Eskimos von Alaska und Kanada erlaubt ist.
Was behagt den Eskimos denn am Grauwal nicht?
Der Grauwal heißt in ihrer Sprache `Teufel´. Er ist zu schnell, zu gefährlich.
Ihn kann man nur mit moderner Technik jagen.
Drei lange Signaltöne bei inzwischen frischer Brise
(Windstärke 5) unterbrechen augenblicklich unser Gespräch: Wal in Sicht!
Blitzschnell ist jeder an seinem Platz, auch der jetzt wichtigste Mann, der
Harpunier. Doch der Kapitän winkt lässig ab, zehn Tonnen Gewicht, schätzt er,
zu mager. Die Jagd wird abgeblasen.
Über uns Kraniche und Kormorane, Schwärme von Wildenten, Wildgänsen und anderen
Seevögeln, hier und da und dort guckt aus dem Wasser der Kopf eines Walrosses,
manches Tier so nah, dass wir einander neugierig in die Augen blicken.
Dann, nach knapp einer Stunde, ganz dicht bei unserem Schiff zwei Walfontänen.
Wieder ertönt das Kampfsignal. Mit Rücksicht auf das jugendliche Alter
des Liebespaares befiehlt der Kapitän jedoch, sie weiterziehen zu lassen, bald
in Richtung Südkalifornien, wo sie sich – auch Wale lieben´s
warm – paaren werden.
Die Lufttemperatur von plus drei Grad, der inzwischen schon starke Wind (Stärke
6 der zwölfteiligen Beautortskala) und auch die vier Grad kalten Meeresschwapper sind nicht gerade dazu angetan, dass wir
uns nun schon fünf Stunden auf schwankenden Planken wohlig warm wähnen.
Doch erst nach zwei Stunden ertönt wieder das Kampfsignal. Die Jagd endet – mit
einem Fehlschuss.
Rings um uns bläst kein Wal, dafür aber der Wind nun schon mit Stärke 7, die
mittlere Wellenhöhe beträgt an die sechs Meter. Wir fühlen uns dem Tode näher
als dem Leben, was man heute noch von keinem Grauwal sagen kann.
Da Leonid Maximowitsch – seit dreißig Jahren
Walfänger, seit siebzehn Jahren Kapitän eines Walfangbootes – als sicher
annimmt, dass sehr bald mit Windstärke 8 (stürmischer Wind, bis zu neun Meter
Wellenhöhe) zu rechnen ist, beschließt er schweren Kapitänsherzens, für heute
seinen Plan unerfüllt zu lassen. Schweren Journalistenherzens hören wir seine
Anweisung, geraden Kurs auf Lorino zu nehmen.
Kurz vor Lorinos Küste eine Funkspruch: `Delegation
muss an Bord übernachten, Ausschicken des Kutters wegen zu hohen Wellenganges
unmöglich.´
Ohne Grauwal und mit gänzlich leerem Magen (was natürlich nicht an mangelnder
Gastfreundschaft der `Swjosdny´-Besatzung liegt) überlassen wir das
mitternächtliche Schlusswort Leonard Maximowitsch Wotrogrow: "Achtundneunzig
Komma fünf Prozent unserer Schüsse treffen ins Schwarze, die eins Komma fünf
Prozent haben Sie heute - leider - miterlebt. Aber hier mein Wort als Kapitän:
Morgen, noch bevor sie Kap Lorino wieder verlassen, sind wir mit einem Wal zur
Stelle.´"
* Nach Tschukoka
begleitete uns meine liebe russische Freundin Raissa Netschajewa, die für die FREIE WELT in unserem Moskauer
Büro arbeitete.

Die Autorin Gisela Reller klettert - ohne Strickleiter - an Bord der "Swjosdny"
--- mit Hackenschuhen (!).
Foto: Detlev Steinberg
Wie entsteht eine
Walfontäne?
Der
Wal ist ein Säugetier. Er atmet nicht mit Kiemen wie ein Fisch, sondern hat eine
Lunge wie jedes andere Säugetier auch, weshalb Walfisch, wie man immer wieder
liest und hört, falsch ist. Die Nase
es Wals sitzt nicht im
"Gesicht", sondern sie ist im Laufe der Entwicklung nach oben auf seinen Kopf gewandert. Grauwale erreichen eine Länge von 13 bis 15 Metern und
ein Gewicht von 25 bis 34 Tonnen. Diese Wale sind schiefergrau bis dunkelgrau. Die Kehle des Grauwals ist in der Regel von zwei, maximal
von bis zu sieben Furchen durchzogen. Auf jeder Seite des Mauls befinden sich
etwa 150 Barten von 40 Zentimetern Länge. Wie kommt
es, dass der Wal bläst? Wenn der Wal
abtaucht, schließt er das Atemloch. Es läuft also kein Wasser hinein. Ein
zweiter Verschluss am Lungeneingang, dem "Gänseschnabel" (Kehlkopf),
verhindert, dass Wasser durch Maul und Speiseröhre in die Lunge dringt, wenn
der Wal unter Wasser frisst. Das Wasser, das man beim Auftauchen hoch spritzen
sieht, kommt gar nicht aus dem Wal: Beim Ausatmen stößt der Wal die Luft
explosionsartig aus der Lunge aus. Sie kühlt durch die plötzliche Ausdehnung so
stark ab, dass der in ihr enthaltende Wasserdampf zu Nebel kondensiert. Die so
entstehende Fontäne ist je nach Walart unterschiedlich geformt. Der Grauwal
kann den Blas bis zu vier Meter hoch
ausstoßen. Das ausgestoßene Wasser-Luftgemisch steigt senkrecht nach oben
und erscheint als herzförmige Nebelsäule.
Kap der guten Zuversicht (LESEPROBE aus " Diesseits und jenseits des
Polarkreises")
"Herrlich, wieder festen Boden unter
den Füßen zu haben. Leichtfüßig bewegen wir uns durch Lorino
(bewohnt von etwa 1 100 Tschuktschen, 200 Eskimos, 50 Russen), besichtigen die
ersten, teilweise noch im Bau befindlichen Steinhäuser mit Bad und zentraler
Heizung, sogar einen Experimentalbau mit Sommerterrasse und Balkon. Unangenehm
nur die vielen frei herumlaufenden Schlittenhunde, bei denen man immer gewärtig
sein muss, angefallen zu werden. Im Sommer, so hören wir, werden sie
freigelassen, und müssen sich – nach dem Motto `Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht (fr)essen´- selbst versorgen.
Plötzlich tut sich was in Lorino: ein Hasten, Jagen,
Rennen in Richtung Meeresküste.
Der Walfänger?
Der Walfänger!
Mit Wal?
Mit Wal!
Da hasten, jagen, rennen auch wir. Als wir atemlos am Ufer ankommen, kribbelt
und krabbelt es dort schon wie in einem Ameisenhaufen. Kaum ist der aus tiefer
Wunde blutende Koloss (nicht der größte seiner Art) an Land, da stürzen sich Lorinos Tschuktschen und Eskimos auch schon über ihn. Die
Männer beginnen augenblicklich, den Grauwal mit langgriffigen Messern zu zerteilen,
genauso wie dereinst ihre Vorväter. Die Kinder säbeln (mundgerechte) Stückchen
aus seiner Haut heraus und verspeisen sie roh an Ort und Stelle mit
Wohlbehagen. Überall am Ufer liegen Walskelette, ich habe es mir - wie
weiland Martin Luther auf der Wartburg – auf einem Walwirbel bequem gemacht.
Da bietet sich meinen Augen ein gar eigentümlich vertraut-fremdes
Bild: Die Frauen haben größere recheckige oder quadratische Stücke Walhaut
herausgeschnitten, sie oben eingekerbt und gehen mit diesen Exemplaren davon
wie unsereins mit Plastiktüten.
Itgylgyn – so heißt die Haut mit dem hellrosa Speck –
gilt bei Tschuktschen und Eskimos seit alters als besonderer Leckebissen. Bei
mir regt sich keinerlei Appetit beim Anblick der schrundig und grob aussehenden
grau gefleckten Walhaut – bis eine Tschuktschenhand
die meine zwingt, den Wal `zu streicheln´. Verblüfft stelle ich fest, dass hier
der Augenschein wieder einmal trügt; die Haut ist ungeheuer glatt, zart – und
da versuch auch ich´s mit einem Stückchen Itgylgyn. Im ersten Augenblick scheint es, als habe man
Gummi im Mund, nach intensivem Kauen jedoch wird der Walspeck ein wenig süßlich
und zergeht auf der Zunge.
Ab Morgen wird es in Lorinos Lebensmittelgeschäft
zentnerweise Walfleisch und Itgylgyn zu kaufen geben:
dreißig Kopeken das Kilo."

Der
Grauwal wird - nur von Männern - mit langen Messern geschlachtet; seine
Fettschicht beträgt
bis zu 50 Zentimeter.
Foto: Detlev Steinberg
Der
Urvater von Juri Rytchëu:
"... Ich war völlig davon
überzeugt, dass ich vom Wal abstammte, bis ich in der Schule hörte, dass der
Mensch, wie sich herausstellte, vom Affen abstammt. Das erzählte uns, ohne
einen Zweifel daran zu lassen, unser Lehrer Dunajewski.
Er berief sich dabei auf den englischen Gelehrten Charles Darwin. Der Affe war
auf einer Seite des Lehrbuchs für Naturwissenschaften abgebildet. Je mehr ich
das Porträt meines angeblichen Ahnen betrachtete, desto mehr packte mich
Widerwillen. Es war unfassbar, dass er unser Verwandter sein sollte, wenn auch
ein entfernter... - In diesem aufgelösten Zustand kam ich nach Hause... Ich
erzählte alles meiner Großmutter. Und sie sagte: "Dieser Darwin ist
Engländer, sagst du? Dann stammen die Engländer offenbar vom Affen ab.
Aber du weißt doch, dass dein
wahrer Urvater der Wal ist."
Juri Rytchëu (tschuktschicher
Schriftsteller, 1930 bis 2008) in:
Alphabet meines Lebens, 2010
Vom Wal zum Hahn
(LESEPROBE aus " Diesseits und
jenseits des Polarkreises")
"Ging der Mann im Winter zur Seetierjagd, so stand seine Frau - auch bei
strengem Frost - Stunden um Stunden am Eingang der Jaranga;
ging er im Sommer, so verharrte sie viele Stunden des Tages unbeweglich wie
eine Statue am Ufer, den Blick in die weite Ferne gerichtet. Sah sie ihn dann
nach Tagen endlich kommen, eilte sie ihm - so war es Tschuktschenbrauch
- mit einer Kelle Wasser entgegen, in der ein Eisstückchen schwamm. Hatte die
Frau die Schnauze des erlegten Seetieres benetzt, reichte sie die Kelle dem
Mann an die Lippen. Doch bevor dieser den ersten erfrischenden Schluck zu sich
nahm, versprühte er einige Tropfen zur See hin. Dank an die Götter, die ihm die
Beute, meist einen Seehund, beschert hatten. Und Dank auch an die Götter, dass
er heimgekehrt war. Wie viele kamen von der Jagd nicht zurück...
Die Jagd auf See war Sache des Mannes, alles, was in der Jaranga
und um diese herum geschah, Sache der Frau: das haltbare Aufbewahren des
Fleisches, das Nähen der Pelzbekleidung, das Füttern der Schlittenhunde, das
Umsorgen der Kinder. Bei den Rentier-Tschuktschen kam
noch hinzu, dass die Frau des Rentiernomaden auch denselben beschwerlichen Weg
wie ihr Mann zurückzulegen hatte, oft Dutzende Kilometer am Tag durch die
wegelose Tundra - immer auf der Spur der Rentierherde.
Heute haben auch die Rentierzüchter ein festes Zuhause, ihre Ehefrauen bleiben
meist daheim. Somit haben die Kinder, wenn sie aus der Schule kommen, und der
Ehemann, zurückgekehrt von der Zwanzig-Tage-Schicht aus der Tundra, ein Daheim
mit Komfort. Viele Frauen arbeiten auch deshalb in für Tschukotka
ganz neuen Wirtschaftszweigen: der Pelztierzucht (dreißig Sowchose)
und der Hühnerzucht - dem Schichtrhythmus ihrer Männer angepasst.
`Wenn mein Mann aus der Tundra nach Hause kommt´, sagt die Geflügelzüchterin Nutewji Jettegina, `empfange ich ihn - so ist es heute in Lorino Tschuktschenbrauch - mit
russischem Schwarzbrot und einer Pfanne Rühreier.´
Hühner? Eier? Rühreier? Wir sagten es schon: Unentwegt wird im hohen Norden
Unmögliches möglich gemacht. Die Geflügelhaltung beispielsweise durch Nutzung
von Thermalquellen.
Als der Forschungsreisende Stepan Kraschenninikow
(1711 bis 1755)
vor über zweihundert Jahren in den äußersten Nordosten der Sowjetunion kam,
weigerten sich die Einheimischen zunächst, dem Besucher die heißen Quellen zu
zeigen. Sie hielten diese für Heimstätten von Göttern und Geistern. Endlich
wiesen sie Kraschenninikow doch den Weg, blieben aber
in gebührender Entfernung zurück. `Als sie sahen, dass wir in den Quellen
badeten..., glaubten sie, wir müssten sofort sterben´, berichtet Kraschenninikow. `Nachdem wir jedoch wohlbehalten wieder
zurückgekehrt waren, erzählten sie in den Siedlungen von unserer Vermessenheit
und konnten sich nicht genug darüber wundern, was wir wohl für Leute seien,
wenn uns nicht einmal die Götter schaden könnten.´
Heute baden zusammen mit uns Journalisten in der Heißwasserquelle Lorinos die Kinder eines Pionierlagers. Selbstverständlich
für sie, unter freiem Himmel bei acht Grad Lufttemperatur in tropisch warmem
Wasser zu baden.
Woher kommt das heiße Wasser?
Unsere Erde ist eine oberflächlich abgekühlte, im Innern noch immer glühende
Kugel, die unentwegt Wärme ausstrahlt: Jeder Quadratzentimeter je Sekunde etwa
eine Mikrokalorie. Geothermale Energie ist in erster Linie Energie geothermalen Wassers, das an vielen Punkten der Erde
selbständig sprudelt oder durch Bohrungen freigesetzt wird. Auf Tschukotka sprudelt es an vielen Stellen selbständig, auch
in Lorino. Die Temperatur des Thermalwassers beträgt
auf dem Territorium der Sowjetunion durchschnittlich fünfzig Grad, auch in Tschukotka. Die von uns besuchte Quelle kommt mit neunzig
Grad an die Oberfläche. Wenn dieses Wasser Wärme an die Wohnhäuser, das
Pionierlage und die Ställe (achthundertvierzig Hühner) abgegeben hat, wird es
mit einer Temperatur von immerhin noch fünfzig Grad dem Gewächshäusern zur
Beheizung zugeleitet, danach gelangt es mit etwa fünfunddreißig Grad ins
Schwimmbecken. Auf Tschukotka gibt es viele solcher
Thermalquellen, deren Wärme bis jetzt noch ungenutzt ist.
Bevor wir mit einem Raupenfahrzeug nach Lawrentija
weiterbefördert werden, stärkt man uns in Lorinos
Pionierlager mit Bratkartoffeln, Spiegeleiern, grünen Gurken, Tomaten,
Radieschen und grünem Lauch - `damit Sie sich im hohen Norden wie zu Hause
fühlen´. Was wir dann auch so ausgiebig tun, als hätten wir wer weiß wie lange
nichts gegessen. Igor, ein zehnjähriger Tschuktschenjunge,
sagt mitfühlend zu uns: `Sie können sich ruhig ein paar Radieschen mitnehmen,
wenn es doch bei Ihnen zu Hause keine gibt.´"
Tschuktschen-Witze: Mit diesen
Witzen wurden (werden?) in der Sowjetunion die Tschuktschen so richtig
verkohlt, z. B.: "Zwei Tschuktschen schauen zum Himmel.
"Eh nu, ein
Flugzeug!" -
"Bestimmt die Regierung!" - "Eh nu, eher
unwahrscheinlich. Wenn´s die Regierung wäre, würden
weiße Männer auf Motorrädern drum herum sein." Oder: "Die Vertreter
verschiedener Völker streiten darüber, welcher Nationalität Lenin war. Der Russe
erklärt: `Er war Russe.´ -`Wieso?´ - `Er ist in Russland
geboren, hat die russische Revolution gemacht und ist in Russland
beerdigt.´ -
Sagt ein Finne: `Er war Finne.´ - `Wieso?´ - `Er hat sich vor dem
Zaren
in Finnland versteckt, dort die russische Revolution vorbereitet und sein
wichtigstes
Lebenswerk in Finnland geschrieben.´ - Meldet sich ein Deutscher
und sagt: `Er war Deutscher.´
- `Wie das?´ - `Er ist in Simbirsk
geboren, nicht weit vom Gebiet der Wolgadeutschen,
hat in Berlin gearbeitet und
fühlte sich schon immer zu Deutschland hingezogen.´ Sagt der Tschuktsche:
`Lenin war Tschuktsche.´
- `Und weshalb?´ - `Er war sehr klug.´
Ich gestehe, dass ich die Tschuktschen-Witze, in
denen das kleine Volk der Tschuktschen so schlecht wegkommt, nicht besonders
mag. Aber - schließlich amüsieren wir uns ja auch über
die Ostfriesen-Witze.
Juri Rytchëu in seinem Buch
"Alphabet meines Lebens": "In der tschuktschischen
Folklore gibt es humoristische Erzählungen, die einem Witz oder einer Anekdote
ähnlich sind, in ihnen sind meist Tiere die Akteure. In russischen Witzen
dagegen Menschen. Am liebsten sind die anonymen Witze, die sich vor allem über
ethnische Besonderheiten lustig machen. So gab es beispielsweise eine Zeit der
armenischen
Witze, und mit wundersamer Beständigkeit werden jüdische Witze
erzählt. Doch nie hätte ich mir träumen lassen, dass mein kleines
tschuktschisches Volk Held zahlloser Witze werden würde, in
denen mein Landsmann als naiver Idiot dargestellt wird, der in die
unterschiedlichsten komischen Situationen gerät. (...) Einmal, in einem kleinen
Kurort
wo wir im Sommer einen Bungalow des Literaturfonds gemietet hatten, hörte ich
durchs Fenster folgenden Dialog meiner Frau mit einem Nachbarjungen: `Stimmt es, dass es in Eurer Familie Tschuktschen
gibt?´, fragte der Junge. - `Ja, das stimmt´, antwortete meine Frau. Guck mal durchs Fenster! Da sitzt einer am Computer.´ Der Junge
blickte mich lange Zeit mit unverhohlener Verwunderung an und sagte dann wie zu sich selbst: `Und ich dachte, Tschuktschen gibt es nur in
Witzen.´"
Andre Länder,
andre Wohlgerüche (LESEPROBE aus
" Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Wir fliegen mit einem Hubschrauber des Typs Mi 4 zusammen mit Gorki, Ostrowski,
Shakespeare, Aitmatow, Rasputin, Strittmatter und
vielen anderen Freunden (in Buchform mit Bibliothekseinband) über endlos
anmutende unbewohnte Tundra. Immer wieder glänzen kristallklare Seen zu uns
herauf, in einigen tummeln sich von keinerlei Anglern gefährdete Fische, aus
hundert Meter Höhe mit dem bloßen Auge zu besichtigen. Der Himmel ist
strahlendblau, die Sonne bescheint graue, rote, schwarze Kegelberge
vulkanischen Ursprungs, auf einigen glitzert schon Neuschnee.
Nach zwanzig Minuten siehst du eine große Jaranga, es
ist das zentrale Zelt der von uns gesuchten Rentierhirten. Über Funk hatten wir
ihren Aufenthaltsort ausgekundschaftet. Wir sind neugierig auf die Rentier-Tschuktschen, die sich oft Hunderte Kilometer von
ihren komfortablen Siedlungen entfernt, einer so überaus rauen Natur stellen.
Und den Wölfen. Und den Bären.
Äußeres und Wesen der ehemals durchweg nomadisierenden Tschuktschen (gemeint
sind die Rentier-Tschuktschen im Gegensatz zu den
sesshaften Küsten-Tschuktschen) werden von
verschiedenen Autoren verschieden ausgelegt. Nicht immer verbirgt sich
Bösartigkeit hinter Abfälligkeit, oft ist es wohl einfach nur das Messen von
Menschen anderer Nationalität und Mentalität mit der eigenen Elle.
Im `Geographischen Handbuch´ des Verlages Velhagen
& Klasing von 1882 werden die Rentier-Tschuktschen
so beschrieben: `Kurz, mit enggeschlitzten, ausdruckslosen Augen. Ihr Wesen ist
düster und dumpf. Es ist, als ob ihre leibliche und geistige Entwicklung durch
Klima und Hunger gehemmt wäre. Unbekannt mit den Lebensgenüssen, vegetieren sie
in einer ertötenden Eintönigkeit. Der Blutumlauf ist langsam, der Herzschlag
schwach, der Geruchssinn fast erstickt.´
Ich habe mir nun mal die Mühe gemacht, Aussagen von Autoren herauszufinden, die
genau das Gegenteil feststellen:
Kurz? Georg Kennan, 1867: `Viele von den
nomadisierenden Tschuktschen zählen zu den größten und stärksten Männern, die
mir je zu Gesicht gekommen sind.´
Enggeschlitzte, ausdruckslose Augen? Gustav A. Ritter, um 1900: `Alle
haben ziemlich große Augen, der Blick ist frei.´
Düsteres, dumpfes Wesen? Adolf Erik Freiherr von Nordenskiöld,
1879: `Sie besitzen stark ausgeprägten Kunstsinn, ihre Erscheinung ist
angenehm, die Haltung stolz.´
Gehemmte Entwicklung? `Die Völker der Erde´, begründet von Bonifacius
Platz, um 1900: `Die Tschuktschen sind sehr bildungsfähig, arbeitsam und so
gastfrei, dass sie dem Gast oft den letzten Vorrat vorsetzen.´
Ertötende Eintönigkeit? `Länderbuch´ der Verlagsdruckerei `Merkur´, um
1900: `Bei den Tschuktschen sind Belustigungen, wie Kampfspiele, Wettläufe,
Wettfahrten üblich.´
Ich sah hünenhafte und kleine Tschuktschen; bescheiden gesenkte Augen und
hellwache; von der Jagd auf Wölfe völlig übermüdete Tschuktschen und
quicklebendige, zu jedem Spaß bereit; in sich zurückgezogene Menschen, eins mit
der Weite der Tundra, und bildungshungrige, in der Schule schon unzufrieden mit
einer Zwei.
Wenige Meter von der Jaranga entfernt klettern wir aus
unserem Hubschrauber. `Jetti, jetti!´
(wörtlich: `Bist du gekommen?´) rufen uns zwei Frauen zur Begrüßung zu. `I-i!´
(`Ja!´) rufen wir gelehrig zurück.
Rultive Ankam gehört zu den Frauen, die auch heute
noch mit ihrem Mann das harte Leben in der Tundra teilen. Tanja Kymytwal wird nach den Sommerferien zur Fachschule für
Rentierzüchter gehen. Hier, bei Rultive Anklam, ist sie nach Abschluss der 10. Klasse im Praktikum,
um zu lernen, eine Jaranga aufzubauen und
einzurichten, über offenem Feuer Tschuktschengerichte
zu kochen, Rentierfleisch zu trocknen und zu räuchern, nach althergebrachtem
Schnitt (aber doch schon mit der Nähmaschine) die Sommer- und Winterbekleidung
der Hirten zu nähen, die Hüte- und Schlittenhunde zu versorgen. Mich kann Rultive Ankam gerade noch vor einer zähnefletschenden
Hundeschnauze retten; die arbeitsgewohnten Eskimohunde langweilen sich im
Sommer so, dass sie nichts dagegen haben, sozusagen mal zur Abwechslung in ein
Gästebein zu beißen.
Bei unserer Ankunft waren die beiden Frauen gerade dabei, die Narten - die Hundeschlitten - kunstgerecht zu beladen; denn
die Herde ist äsend schon weit weggelaufen, so dass die beiden Frauen mit dem
ganzen Hausrat schnellstens hintereilen müssen.
Rultive Ankam hat fünf Söhne, `leider´ bedauert sie,
`fühlt sich nur einer der Tundra verpflichtet...´
Die Fünfzigjährige und die Sechzehnjährige sind Tschuktschinnen.
Auf Tschukotka besteht eine Rentierzüchterbrigade aus
elf Personen, durchschnittlich 40 Prozent davon sind Frauen. Und so sieht die
nationale Zusammensetzung der Brigaden aus: Die größte Gruppe bilden mit 80,1
Prozent die Tschuktschen, es folgen mit 10,7 Prozent die Ewenen
(10 Prozent sind Frauen), dann mit 3,2 Prozent die Tschuwanzen
(2,4 Prozent sind Frauen), auch 0,4 Prozent Russen und 0,4 Prozent Ukrainer
versuchen sich in der Rentierzucht; denn gegenwärtig herrscht bei Rentierhirten
und -züchtern beängstigender Personalmangel. Bei den Eskimos stoßen alle
Werbefeldzüge auf taube Ohren. Die Meerestierjäger ziehen es vor, da ja heute
die Meerestierjagd sehr eingeschränkt ist, Fischer zu werden oder - Pelztiere
zu züchten, `die man wenigsten mit Meeresgetier füttern kann´.
Rultive Ankam fragt zweifelnd, so scheint es uns, ob
sie die von fernher gekommenen Gäste in die Jaranga
bitten dürfe.
Auf den ersten Blick bietet das Innenlegen dieses Wohnzeltes ein wüstes
Durcheinander: in einer Ecke ein aufdringlich riechender Haufen noch
unbearbeiteter Rentierfelle, in einer anderen ein zum Räuchern bestimmter
blutiger Fleischberg; hier eine Menge rohe Rentierlungen und eine Masse
getrockneter Fisch, Nahrung für die Hunde; da ein Haufen frisch abgezogener
Rentierläufe und hier große Fleischstücke, vorbereitet für das Abendessen; auf
Leinen hängen zum Trocknen Rentiersehnen, mit denen die Torbasen (Fellstiefel)
genäht werden sollen, und schon bearbeitete Felle, aus denen an Ort und Stelle
die Winterkleidung - ein Fell mit dem Haarkleid nach außen, eins mit den Haaren
nach innen - gefertigt wird; an den Wänden Säcke aus Rentierleder zum
Aufbewahren von Nahrungsmitteln; nahe dem Eingang das offene Feuer mit dem
rußgeschwärzten brodelnden Kochkessel.
Die Nase, das lässt sich denken, möchtest du dir am liebsten zuhalten.
Von Rultive Ankam erfahren wir jedoch sogleich, dass
das Innere einer Jarana - Stillleben nur für
europäische Augen - ganz und gar sinnvoll untergliedert ist: in den Schatjor, den Wohnraum der Brigade; in dem alle
Brigademitglieder - sich gegenseitig wärmend - eng beieinander liegen; in den Tschottagin, den ungeheizten Teil der Jaranga
für die Hüte- und Schlittenhunde, die äußerlich Wölfen ähnlich, nur ihrem Herrn
gehorchen.
Und was den Geruchssinn angeht - er ist bei den Einheimischen durchaus
nicht erstickt, sondern im im Gegenteil
`ungewöhnlich gut entwickelt´ (Nikolai Schundik
in: `Der weiße
Schamane´).
Mit Aufgeschlossenheit dem fremdem Unbekannten gegenüber wäre zu sagen: Andre
Länder, andre Wohlgerüche!
Dann gehen wir noch einmal in die Luft, um die Rentierhirten und -züchter mit
ihrer Herde zu suchen. Nach wenigen Minuten sind sie schon in Sicht. Wir landen
zwei Kilometer entfernt, um die halbwilden scheuen Tiere nicht aufzuschrecken.
Auf den zwei Kilometern zu Fuß staunen wir nicht schlecht über die Artenfülle
der arktischen Vegetation. Wir bewundern schneeweißes Wollgras, das sich im -
ausnahmsweise - hauchzarten Winde wiegt, blaue Glockenblumen, violettes Sedum, rote Preiselbeeren; gelbe, lila, orange, braune,
hellblaue Blüten; ich erfreue mich noch an den zwischen den Seiten meines
Notizbuches getrockneten Pflanzen beim Schreiben dieser Zeilen. Unser Begleiter
Tolja weiß, dass siebenhundertzweiundsechzig Arten
arktischer Blütenpflanzen bekannt sind, dreihundertzweiunddreißig Moos- und
zweihundertfünfzig Flechtenarten. Die Baumvegetation besteht hier, jenseits des
geschlossenen arktischen Waldes, immerhin noch aus etwa kniehohen Zwergbirken
und Weiden. Der Brigadeleiter ist Nikolai Änuk. Seit
fast dreißig Jahren ist er im ständigen Weidewechsel hinter den Rentieren her.
Das sind mehr als dreißigtausend Kilometer, meist zu Fuß.
Im Tschuktschenland weidet die größte Rentierherde
der Welt, eine dreiviertel Million Tiere. Das Rentier, auch Ren, gehört zu den
wenigen Säugetieren, die unter den extremen Bedingungen des hohen Nordens von
dem Vorhandenen leben können. Über das Ren hat Nikolai Änuk
viel Interessantes, ja Außergewöhnliches zu erzählen. Und so erfahren wir, dass
das Ren die einzige Hirschart ist, bei der beide Geschlechter ein Geweih
tragen. Dann hat das Ren die ungewöhnliche Fähigkeit, lange ohne Salz auszukommen.
Den lieben langen Polarwinter über lebt das anspruchslose Ren nur von Schnee
und Rentiermoos, das es mit Hufen, Muffel und Geweih ausgräbt. Wodurch das
Fleisch vom Rentier dreimal weniger kostet als das von den anderen in den
gleichen Gebieten aufgezogenen Fleischtieren.
Im winterlichen Hungerdasein zehrt das Rentier oft alle Reserven, dabei auch
bis zu ein Fünftel der Muskeln auf. Typisch für die Tundrarentiere
ist, dass sie je nach der Jahreszeit ihre Wohngebiete wechseln, wobei sie
teilweise große Wanderungen über Land und eisbedecktes Meer antreten.
Zu Beginn des Sommers führt der Zug der Rentiere weit nach Norden, im dunklen
Polarwinter dagegen suchen sie die an die Tundra grenzenden lockeren
Waldbestände auf, die ihnen Schutz vor dem eisigen Sturm bieten. Noch vor
Eintritt des Frühlings verlassen die Rene diesen Schutzstreifen wieder, um
zurück in die offene Tundra zu eilen. Hier sind sie einigermaßen sicher vor den
gefürchteten Stechmücken, Dasselfliegen, Rachenbremsen und anderen Insekten, aber
auch vor der sommerlichen Wärme, da die extreme Anpassung an das arktische
Klima - auch im Sommerfell - den Wärmeausgleich behindert. Und auch Rätsel gibt
uns das Ren auf: Haben alle Paarhufer zwei Lungenflügel, hat das Rentier drei.
Früher vermutete man, dass es sie braucht, um beim schnellen Lauf nicht außer
Atem zu kommen. Heute weiß man aber, dass das Ren bei wildem Lauf nur siebenmal
mehr Sauerstoff braucht als im Ruhezustand, während der Mensch das Zehn- und
Vierzehnfache benötigt. Demnach müssten dem Rentier zwei Lungenflügel durchaus
genügen.
Auch einen anderen Umstand weiß man bis heute nicht zu deuten. Wenn die
Rentiere durch die Tundra laufen, hört man ein Geräusch wie elektrisches
Knistern. Die Rentierzüchter nennen es `Geläut´. Was bedeutet, es, wie kommt es
zustande? Das weiß auch Nikoali Änuk nicht zu
erklären, trotz seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung.
Ein tschuktschisches Sprichwort lautet: `In der Herde
braucht´s Beine statt Arme.´ Wie wichtig jedoch auch
die Arme des Rentierhirten sind, zeigt uns Nikoali Änuk,
als er mit dem zwanzig Meter langen Schajut, dem
Lasso, auf Anhieb das zum Schlachten bestimmte Ren einfängt. `Ja´, nickt er,
`auch Köpfchen muss ein Rentierzüchter haben, Kombinationsgabe zuzusagen,
geboren aus Überlieferung, eigener Erfahrung, wissen um die Rentierpsyche und
plötzlich wechselnde Wetterbedingungen. Zur rechten Zeit muss der
Rentierzüchter wissen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Verzögert er eine
Entscheidung, so kann es Hunderte von Tieren das Leben kosten.´ Heute muss auch
jedes Mitglied einer Rentierzüchterbrigade mit neuer Technik umgehen können und
veterinärmedizinische Grundkenntnisse besitzen.
Aber trotz kettengetriebener Geländefahrzeuge, trotz ständiger Funkverbindung
zum Sowchos, trotz Schichtarbeit - damit die Hirten
in bestimmtem Rhythmus mit ihren Familien zusammen sein können - ist der Beruf
des Rentierzüchters noch immer einer der beschwerlichsten. So erzählt Nikolai Änuk, der mittelgroße wettergehärtete Mann: `Einmal wurden
die Tiere von Myriaden von Stechmücken so gepeinigt, dass sie panikartig einem
aufgekommenen erfrischenden Nordwind entgegen rannten. Nach drei Tagen
ununterbrochener Jagd hatte ich das Leittier endlich eingeholt und konnte die
Herde zum Stehen bringen. Wäre mir das nicht gelungen, hätten sich die Tiere in
alle Himmelsrichtungen zerstreut, dem Tode geweiht. Unsere Herde besteht aus
zweitausend Tieren, wovon jedes Ren im Jahr fünfzig Hektar Weideland
beansprucht. Tag und Nacht muss die Herde bewacht werden, auch bei Schneesturm
und klirrendem Frost. Und im Winter, da werden wir fast jede Nacht von Wölfen
heimgesucht.´ Nach Angaben des Jagdoberinspektors von Tschukotka
sind innerhalb der letzten sechs Jahre 29 500 Rentiere von Raubtieren, meist
Wölfen, getötet worden.
Was Wunder, wenn ein Teil der Jugend - da Komfort auch in die arktischen
Breiten eingezogen ist - nach nicht ganz so rauen Berufen Ausschau hält."
Das Neueste vom
Rentier:
2011 berichteten Forscher in einer Studie im "Journal
of Experimental Biology", dass Rentiere UV-Licht wahrnehmen. Ultraviolettes Licht können die meisten Säugetiere nicht sehen;
denn ihre Linsen filtern dieses sehr kurzwellige Licht aus dem Gesamtspektrum
des Sonnenlichts heraus, wodurch besonders empfindliche Teile des Auges wie die
Netzhaut vor möglichen Schäden durch die energiereiche Strahlung geschützt
bleiben. Rentieren hilft die UV-Sicht, in den weiten Schneelandschaften ihres
Lebensraumes überlebensnotwendige Futterquellen oder Fressfeinde leichter
auszumachen. Die Sicht der Tiere reicht in Wellenlängenbereiche, die für das
menschliche Auge nur durch technische Hilfsmittel sichtbar gemacht werden
können. "Es bleibt die Frage, warum UV-Licht die Augen von Rentieren nicht
zu schädigen scheint", rätselt Glem
Jeffery vom University College London, Hauptautor der
Studie. "Vielleicht ist es nicht so schädlich für die Augen, wie wir
bisher dachten? Oder die Rentiere haben einen einzigartigen Weg gefunden, sich
zu schützen. Davon könnte man lernen, neue Strategien zum Schutz vor oder für
die Behandlung von UV-Schäden am menschlichen Auge zu entwickeln, wie sie etwa bei
Schneeblindheit entstehen."
Warten auf
Flugwetter (LESEPROBE aus "
Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Im fernab gelegenen Lawrentija ist das Hotel `Norden´ bis unters Dach besetzt.
Ich staune darüber so, dass ich den erstbesten Hotelgast nach Woher und Wohin
befrage. Es ist der Pelztierjäger Roman Armaritschin,
ein Tschuktsche aus Uëlen.
Er hatte Urlaub, wollte sich `auf dem Festland´ die Stadt Uëlen
ansehen, einen Abstecher in den Kaukasus machen und mal in Mittelasien
`vorbeigucken´. Ein Nordbewohner bekommt nur alle drei Jahre Urlaub, dann aber
gleich ein halbes Jahr, denn bei den weiten Wegstrecken würden die wenigen europäischen
Urlaubswochen im wahrsten Sinne des Wortes nicht hin und nicht her reichen.
Doch ohne Mittelasien erblickt zu haben, war Roman Armaritschin
vorzeitig zurückgekehrt. `Heimweh hatte ich, oh, was für ein schreckliches
Heimweh.´ Überall sei es interessant gewesen, beeilt er sich zu versichern...,
aber Tundra bleibe Tundra, für ihn jedenfalls. Er könne es kaum erwarten, bis
die Zeit der Jagd auf Polarfüchse wieder heran sei. Jetzt allerdings warte er,
wie die meisten anderen Hotelgäste auch, schon den neunzehnten Tag auf
Flugwetter. Mal seien dichter Nebel und Sturm in Lawrentija,
mal in Uëlen, mal auf der durchweg gebirgigen
Flugstrecke. Mit so ein bisschen Verspätung müsse man im hohen Norden immer
rechnen, denn die Sicherheit der Fluggäste, das sagt er sehr stolz, gehe hier
über alles. Bei dem Gedanken, was unser Chefredakteur dazu sagen würde, wenn
wir mit `so ein bisschen Verspätung´ wieder in Berlin einträfen, läuft es mir
kalt den Rüchen hinunter.
Während des Mittagessens informiert uns unser Betreuer Tolja,
dass in dreißig Minuten ein Hubschrauber nach Uëlen
starte und wir mit ebendiesem Hubschrauber fliegen würden. Obwohl der `tolle Tolja´ das so sagt, als wäre dies das Selbstverständlichste
der Nordhalbkugel, bleibt uns vor Überraschung fast der Rentierbissen im Halse
stecken. Ganz ruhig fügt Tolja dann noch hinzu, dass
er uns rate, Kleidung zum Wechseln mitzunehmen, denn er habe in Uëlen schon einmal achtundzwanzig Tage auf Rückflugwetter
warten müssen. (Als wir in Berlin mit dem Finger auf der Landkarte unsere
Konzeption erarbeiteten, hatten wir für den Katzensprung von Lawrentija nach Uëlen einen
halben Tag eingeplant.)
Nun nicken wir (scheinbar) nördlich ruhig wie Tolja
mit dem Kopf, so als fänden wir es ganz selbstverständlich, mehr als einen
Jahresurlaub in Uëlen auf einen Rückflug zu warten.
Dann stürze ich ins Zimmer und weiß nicht, was ich für einen Ausflug, der
Stunden dauern soll und Wochen währen kann, mitnehmen soll.
In Lawrentija gab
es ab Mitte der neunziger Jahre lange überhaupt kein Gehalt, "stattdessen
wurden Lebensmittel zugeteilt wie im Krieg. (...) So gab es zum Beispiel 500
Gramm Zucker im Monat. Butter hätten sie vor ein paar Monaten nach knapp
fünf Jahren wieder zum ersten mal gesehen und gegessen. Ein Feiertag sei das
gewesen. (...) Ein Blick in den kleinen, nicht gerade opulent bestückten
Laden von Lawrentija lässt mich ungläubig staunen. Eine Flasche Cola kostet
hier fast zehn Mark. Auch sonst ist alles rund 200 Prozent teurer als zum
Beispiel in Moskau, und Moskau ist ein teures Pflaster verglichen mit dem
übrigen Russland. Alles muss mit dem Schiff oder einem Flugzeug hierher
transportiert werden; das macht sich bei den Preisen bemerkbar. Wer
heutzutage hier wohnt, sitzt in der Falle." (Zu Sowjetzeiten kosteten die
Waren im hohen Norden genau soviel wie im übrigen Russland!)
Thomas Roth in: Russisches Tagebuch,
2002
Auf dem Flugplatz von Lawrentija steht Hubschrauber an Hubschrauber, beliebtestes
Luftverkehrsmittel des hohen Nordens. Es wimmelt hier von Menschen wie auf
einem orientalischen Basar. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen,
was all die Leute ausgerechnet im äußersten Nordosten der Sowjetunion zu suchen
haben.
Nun, da sind Meteorologen, Geologen, Glaziologen, Archäologen; Urlauber,
Studenten, Ferienlagerkinder; Töchter, Söhne, Eltern, Verwandte, Bekannte...
Und - unglaublich - alle lächeln verständnisvoll-freundlich, da wir - als
letzte die ersten - in den Hubschrauber klettern.
Als wir nach zweiundzwanzig Minuten am nordöstlichsten Ziel unserer Träume
angekommen sind, hören wir von German Petrowitsch Wolkow, einem der russischen Piloten, dass die
Geschwindigkeit einhundertsechzig Kilometer je Stunde betragen hatte, die Höhe zwischen
achtzig und zweihundert Metern schwankte, um den noch immer starken Nebel- und
Wolkenfeldern auszuweichen. Und streng fügt er hinzu: `Wenn ich Sie durch
irgend jemanden zurückholen lasse, säumen Sie nicht, kommen Sie sofort, dann
ist das Wetter wieder schlechter geworden.´"
Vor und
nach dem Zerfall der Sowjetunion: Der
"Spiegel" vom Dezember 2000 zitiert den Dorf- und Kolchosvorsteher
Arkadij Makuschkin mit den Worten, wenn er zwischen
dem Milliardär Roman Abramowitsch und dem
Sowjetsystem wählen könnte, würde er das Sowjetsystem zurückhaben
wollen, "jedenfalls in der Wirtschaft: Anders kann der Norden nicht überleben." Diese "jungen Burschen wie
Abramowitsch",
fürchtet er, würden "den ungeheuren Reichtum Tschukotkas
unter sich aufteilen". Kein Wirtschaftszweig auf Tschukotka,
der nicht Not leidend ist. Selbst die Goldgewinnung, seit 1998 um fast die
Hälfte im Jahr gesunken, ist inzwischen unrentabel. Tuberkulose, Trunksucht,
hohe Selbstmordraten, 70 Prozent Arbeitslosigkeit. "Tschukotka",
schreibt die "Wersija", "droht der
Tod". Wozu braucht Roman Abramowitsch das seit
dem Zerfall der Sowjetunion von der russischen Regierung im Stich gelassene
Land? Der "Spiegel" vermutet, dass eine einflussreiche Kreml-Fraktion
Abramowitsch stützt. "Wladimir Putin lässt sie
mit Verve verbreiten, sei entzückt vom praktischen Patriotismus des angeblich
langjährigen Kämmerers der Jelzin-Familie. Um Gnade zu finden beim neuen
Zuchtmeister der russischen Nation sei es für neureiche Reformgewinnler
durchaus der rechte, vielleicht sogar der einzige Weg,
sich heruntergewirtschafteter Regionen anzunehmen. Schon den Einzug ins
russische Zentralparlament hatte sich der bis dahin öffentlichkeitsscheue
Geldmann mit Wohltaten für die auf Notration gesetzte Bevölkerung gepflastert.
Pro Kopf ließ Abramowitsch 120 Kilogramm Lebensmittel
verteilen. Vor der Gouverneurswahl, die er dann 2000 auch tatsächlich gewann,
waren es sogar 150 Kilogramm, die der Dampfer
"Wassilij
Glawnik" aus Wladiwostok heranschaffte.
Im
nordöstlichsten Wohnort Russlands (LESEPROBE
aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Die Siedlung Uëlen steht auf einer steinigen
Landzunge zwischen Meerenge und Lagune, ganze vier Kilometer breit und fünfzehn
Kilometer lang. Achthundertsiebzig Menschen wohnen hier, vorrangig
Tschuktschen, wenige Eskimos, etwa fünfzig Russen - Spezialisten von
Ausbildungsstätten, der Polarstation, der Grenzsicherung.
Jenseits der Beringstraße liegt - bei günstigem Wetter von Uëlen
mit dem Fernglas auszumachen - Alaska, der 49. Bundesstaat der USA.
"Als Ende 1954 in Moskau der zweite Volkskongress des sowjetischen
Schriftstellerverbandes beginnt,
hat sich äußerlich noch nicht viel verändert.
Das Volk hat im März 1953 aufrichtig um Stalin getrauert. Der geliebte Vater der
Nation
ist neben Lenin im Mausoleum beigesetzt
worden. Bis jetzt weist nichts auf die bevorstehende Enthüllung der Gräueltaten
hin, obwohl Stalins
treuester Adjutant, NKWD-Chef Lawrenti Berija
noch im selben Jahr hingerichtet und aus der Großen Sowjetenzyklopädie der
Sowjetunion
gestrichen worden ist. (Abonnenten im In- und Ausland sandte man
ein lose eingelegtes Blatt über die
Beringstraße
zu und wies sie an, dieses über das Stichwort `Berija´ zu kleben.)
Frank Westerman in: Ingenieure der Seele, 2003
1867 hatte
Zar Alexander II. das seit seiner Entdeckung 1741 durch Bering und Tschirikow in russischem Besitz befindliche Land
verschachert: 1 518 800 Quadratkilometer für 7,2 Millionen Rubel. Auf diese
lächerlich geringe Summe hatten sich Russlands Beauftragter Stoeckl
und Amerikas Außenminister Seward verständigt. Der
Zar brauchte Geld, und den Amerikanern lag an dem Wohlwollen der Russen. Zwei
Jahre zog sich dennoch die Tilgung der vereinbarten Summe hin, denn der
amerikanische Kongress konnte und konnte sich nicht entschließen, dieser - wie
man gemeinhin meinte - Fehlinvestition Sewards
zuzustimmen. Als man in St. Petersburg bereits erwog, die Amerikaner in einer
gleichermaßen zynischen wie stolzen Note aufzufordern, entweder sofort zu
zahlen oder Alaska als Geschenk anzunehmen, traf endlich der telegraphisch
übermittelte Vertrag ein, von Seward auf eigene
Kosten für neuntausend Dollar nach St. Petersburg durchgegeben. Für die
Amerikaner war Alaska fortan `Sewards Kühlschrank´
oder `Sewards Unfug´. Doch schon dreißig Jahre später
brach der Klondike-Goldrausch aus, und man entdeckte
außerdem reiche Vorkommen an Erdöl, Kupfer, Zinn, Chrom, Platin. Ein
Jahrhundert nach dem Verkauf Alaskas - 1968 - fand man im arktischen Gebiet der
Prudhoe-Bai riesige Mengen Erdöl und Erdgas. Reiche
Konzerne sicherten sich jenes Gebiet für neunzig Millionen Dollar - zwölf mal
mehr, als der russische Zar für ganz Alaska einst erhalten hatte. `Sewards Unfug´ war zum großen Geschäft der USA geworden.
Überhaupt haben die Amerikaner von Alaska aus noch bis in die zwanziger Jahre
ihre einträglichen Geschäfte mit den Ureinwohnern Tschukotkas
betrieben. Die alten Einwohner Uëlens wissen noch zu
bestätigen, dass zum Beispiel der Preis für ein einziges Pud
Tabak der amerikanischen Firma Hudson - die eine Niederlassung im so nahe
gelegenen Uëlen hatte - achtzig (!) Walrossstoßzähne
betrug.
Die Stoßzähne eines ausgewachsenen Walrosses werden bis zu fünfundsiebzig
Zentimeter lang, ein Zahn wiegt etwa zwei Kilogramm. Sie dienen zur
Nahrungssuche, zur Verteidigung, zum Klettern auf Eisschollen und dazu, Löcher
in das Eis zu schlagen. Solange die Walrosse von den Ureinwohnern mit Pfeil und
Handharpune gejagt wurden, war ihr Bestand durch nichts bedroht. Doch dann
kamen Anfang des 19. Jahrhunderts die ausländischen Elfenbeinjäger mit ihren
Feuerwaffen. Heute, da nur noch einigen wenigen Völkern des hohen Nordens die
Jagd auf Walrosse gestattet ist, wuchs ihre Zahl in den sowjetischen Küstergewässern
in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf das Dreieinhalbfache an. Allein im
Beringmeer, in der Tschuktschensee und in der Ostsibirischen See zählte man
kürzlich wieder einhundertachtzigtausend Tiere.
Vom Hubschrauberlandeplatz laufen wir etwa einen Kilometer durch Uëlen, vorbei an schmucken Holzhäusern - wo noch vor
wenigen Jahrzehnten nur Jarangas standen. Schnee und
Sturm wüten hier, dass uns Hören und Sehen vergeht. Es scheint, als seien die
beiden Ozeane um des winzigen Stückchen Landes wegen in bitterbösen Streit
geraten. Unser Ziel ist eins der wenigen zweigeschossigen Steinhäuser Uëlens, die Uëlener
Knochenschnitzwerkstatt.
Seit alters schnitzen und gravieren Küsten-Tschuktschen
und Eskimos in die Elfenbeinhauer des Walrosses Szenen ihres arktischen Lebens.
Einst taten sie es ohne Wissen um künstlerische Ausdrucksmittel, heute wirken
sie als bewusste Künstler.
In der Graveurwerkstatt arbeitet seit 1948 Jelena Janku,
weit älter als sechzig, Gesicht und Hände voller Runzeln, unscheinbar im blauen
Arbeitskittel. Doch ihre Hände, die Hände einer Verdienten Künstlerin der
RSFSR, zaubern märchenhaft schöne Motive auf die Walrosshauer, zum Beispiel
`Die Jagd auf Walrosse an ihrem Liegeplatz´: Dicht an dicht lagern die
tonnenschweren Tiere bei- und aufeinander - eine Masse von individuell
verschieden abgestuften braunen Körpern. Mit unterschiedlich grauen Steinen ist
das Meeresufer übersät, am Horizont Kegelberg an Kegelberg. Die ausgesparten
Flächen sind nicht einfach hell, sondern bieten sich als unendliche
Schneefläche dar.
Ein solches Sujet komme zustande, sagt Jelena Janku,
wie ein alttschuktschisches Lied entstand. Da sei es
üblich gewesen, in eine bestimmte Melodie einfach Worte einzuflechten, Worte
vom Jagderfolg, vom Wetter, von Eis und Schnee... In einem Tschuktschenlied
singt man etwa so: `Ich freue mich sehr, dass ich eine Walrosshaut besitze,
lass mich ein Lied über die erlegte Walrosshaut ersinnen. Ein Walross liegt auf
einer Eisscholle. Jetzt bereite ich die Harpune vor. Harpuniere. Zerre das
Walross herbei. Ich freue mich, dass ich eine Walrosshaut besitze...´
Jelena Jankus Lieblingsfarbe ist verhaltenes
Graublau, die grellen Farben, so sagt sie, überlasse sie der Jugend. Die
Farbgravur gibt es erst seit den vierziger Jahren, davor kannte man keinen
bunten Graphit auf Tschukotka; man färbte die mit
einem Stichel in Elfenbein eingeritzten Vertiefungen mit schwarzem Ruß.
Jelena Janku bildet an ihrem Arbeitsplatz immer vier
Lehrlinge gleichzeitig aus, ihr Gehalt beträgt etwa vierhundert Rubel. Mehr
wert als Geld seien ihr, so versichert sie, die warmherzigen Worte des
bekannten amerikanischen Malers und Grafikers Rockwell Kent (1882 bis 1971),
der ihr 1962 in einem langen Brief aus New York u. a. schrieb: `Die Grafik der
Tschuktschen und asiatischen Eskimos auf Walrossstoßzahn ist ein Wunder Ihres
Landes. Ihre Kunst, liebe Jelena Janku, ist
Lebenswahrheit, durch die die Seele Ihres Volkes erkennbar wird.´
In der Schnitzwerkstatt arbeitet seit 1945 Wassili Kumukai. Anfang der zwanziger Jahre war er einer von denen,
die in Uëlen halfen, die Sowjetmacht zu festigen.
Jahrelang Komsomolsekretär, dann Mitglied der KPdSU,
ist er mit über siebzig noch lange nicht willens, so sagt er, sich zur Ruhe zu
setzen. Tut er es irgendwann, so werden viele junge Leute enttäuscht sein. Aus
allen möglichen Siedlungen Tschukotkas nämlich kommen
sie seinetwegen hierher ins Uëlener Internat. Pawel Numunkal zum Beispiel möchte einmal auf einer Kunstschule
studieren. Aber erst will er sich alle Fertigkeiten bei Kumukai
abgucken, von dessen Schnitzwundern er schon als kleiner Junge begeistert war.
(Mir schenkt Wassili Kumukai
einen Walrossstoßzahn, den ich mir seit damals immer mal wieder mit Freude und
Hochachtung ansehe.)

Wassili Kumukai in der Schnitzwerkstatt in Uelen - mit einem seiner
Elfenbein-Meisterwerke.
Foto: Detlev Steinberg
Das Schnitzen in Elfenbein ist neben der Gravur die zweite Richtung der
Elfenbeinkunst der Tschuktschen und Eskimos. Man schnitzt einzelne Tiere und
ganze Gruppen. Gerade aalen sich in der Schnitzwerkstatt drei schwerfällige
Walrosse in der Sonne, neckt ein Eisbärjunges einen
kleinen Seehund, kämpft ein Wolf mit einem Rentier. Aber nicht nur Tiergruppen
werden dargestellt, sondern auch Szenen mit Mensch und Tier - es sind
regelrechte bildhauerische Kunstwerke. Wassili Kumukai ist Spezialist für Messergriffe. Auf ihnen tummelt
sich alles, was im arktischen Norden kreucht und fleucht.
Auffällig ist die Bescheidenheit aller Graveure und Schnitzer - so als ahnten
sie gar nicht, was für große Künstler die meisten von ihnen sind.
Alexander Sergejewitsch Jakowtschuk, den jungen
Direktor der Uelener Knochenschnitzwerkstatt, fragen
wir nach vielen Einzelheiten:
Alexander Segejewitsch, wahrlich, wir haben rare
Kunst zu sehen bekommen.
Schön, dass Ihnen unsere Produkte gefallen. Zwischenzeitlich war es gar nicht
so einfach, das Niveau dieser mehr als zweitausend Jahre alten Kunst auf diesem
hohen Niveau zu halten.
Weil die Meister ausstarben?
Ja, aber es gab auch andere Gründe. Obwohl Uëlen
sozusagen am Rande der Welt liegt, dringt über Rundfunk und Presse auch die
kleinste Neuigkeit zu uns. Nun, und unsere Meister hatten natürlich den
Ehrgeiz, auch die Veränderungen darzustellen. Da aber haperte es damals leider
oft noch mit der künstlerischen Ausdruckskraft. Was aber wohl das wichtigste
war, alle fertigen Arbeiten gingen früher sofort in den freien Verkauf. Wir
hatten keine Möglichkeiten, unsere Lehrlinge an praktischen Beispielen zu
schulen. Seit etwa zwanzig Jahren fotografieren wir alle künstlerisch
gelungenen Gegenstände und sammeln sie in Alben; sie sind sozusagen unsre
Lehrbücher.
Außerdem haben Sie Anfang der sechziger
Jahre, so hörten wir, ein Museum eingerichtet...
... in das jedes Original geht. In den Verkauf gelangen heute nur noch Kopien.
Seit wann existieren diese Werkstätten?
Sie wurden 1931 von Wukwutagin gegründet, mit einer
Belegschaft von - drei Personen. Der Elfenbeinkünstler Wukwutagin
wurde als einer der ersten Tschuktschen mit dem Leninorden ausgezeichnet. Heute
arbeiten hier sechzig Menschen, vierzehn davon sind Mitglieder des Verbandes
Bildender Künstler der UdSSR.
Aber Ihre Werkstätten tragen nicht den Namen des Begründers...
... sondern den Namen eines anderen Elfenbeinkünstlers aus Uëlen,
den Namen des Wukwol. Er wurde 1913 in der Familie
eines armen Meerestierjägers geboren. Er war einer der ersten auf Tschukotka, der in die Pionierorganisation eintrat. Wukwol studierte in Moskau und Leningrad. Alle seine Lehrer
hielten ihn für ungewöhnlich begabt und talentiert. Er träumte von der
Schaffung einer eigenschöpferischen tschuktschischen
und eskimoischen Kunst. Aber - Wukwol
fiel im Großen Vaterländischen Krieg. Auch die Menschen in der letzten
nordöstlichen bewohnten Siedlung der Sowjetunion hat dieser blutige Krieg nicht
verschont! Von Wukwol stammt die Gravur auf
Walrosselfenbein `Legende um Lenin´. [Wukwol hat
1932 die erste Fibel illustriert.]
Im Magadaner Heimatkundemuseum sahen wir eine
Kopie des Walrosszahns `Legende um Lenin´. Was ist das für eine Legende?
Das Original befindet sich im Lenin-Mausoleum in Moskau. Die Legende? An den
Lagerfeuern der Tschuktschen erzählte man sich in den zwanziger Jahren, es habe
sich ein gerechter Russe zu Fuß nach Tschukotka
aufgemacht, um eine immer scheinende Sonne zu bringen. Der Name dieses Russen
war Lenin. Von Tschukotka sagt man, es sei die Heimat
des Winters. Da wünschen sich die Menschen nichts so sehnlich wie die Sonne...
Sie bezeichnen Ihren Betrieb als Souvenirwerkstatt...
Früher war die Elfenbeinkunst ja nur ein Nebenprodukt. In den grimmigen
Wintermonaten, wenn keine Jagd möglich war, vertrieb man sich die Zeit,
Gebrauchsgegenstände aus Walrosselfenbein zu schnitzen und zu verzieren, zum
Beispiel Harpunenspitzen, Haken zum Abschleppen der erlegten Meerestiere,
Schneebrillen, Pfeifen, Eimerhenkel, Tröge, Messer, auch Amulette wurden
geschnitzt. Kein Jäger ging früher aufs Meer ohne den aus Fischbein
geschnitzten Peliken, den lustigen weisen Gott der
Meerestierjäger. Inzwischen wird die Kunst des Schnitzens in Elfenbein hauptberuflich betrieben.
Statt Haushaltsgegenstände und Erzeugnisse mit Kultcharakter fertigen wir
Kunsterzeugnisse als Andenken und Geschenkartikel. Seit einigen Jahren
gravieren wir das steinharte Material nicht mehr mit einem einfachen Stichel,
sondern mit Zahnarztbohrern.
Welche Themen werden bevorzugt?
Traditionelle Sujets, die das Leben auf dem Meer und in der Tundra zeigen,
neuzeitliche Themen, die wir inzwischen darzustellen gelernt haben, vorrangig
Märchen und Legenden. Die Gravuren und Schnitzereien in Walross-Elfenbein sind eine
besonders schöne Möglichkeit, die reiche folkloristische Vergangenheit der
Tschuktschen und Eskimos zu bewahren. Arbeiten aus Uëlen
wurden im Ausland schon auf vielen Ausstellungen gezeigt: in Paris, Brüssel,
Montreal, Osaka, Tokio...
Früher beschäftigten sich mit der Elfenbeinkunst
ausschließlich Männer...
Das lag an der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Die Frau
versah alle Arbeiten in der Jaranga. Die Männer aber
hatten witterungsbedingt Freizeit. Heute stehen die Frauen den Männern auch in
der Schnitzkunst nicht nach. Bei uns arbeiten inzwischen mehr Frauen als
Männer. Es gibt bis jetzt aber nur wenige Meisterinnen ihres Fachs.
Wir sahen auch Gegenstände aus Walknochen...
Da wir nicht mehr nur saisonbedingt arbeiten, haben wir Materialmangel. Sie
wissen, dass eine bestimmte Anzahl Walrosse gejagt werden darf. Deshalb
erschließen wir uns seit 1975 auch andere Materialien: Walknochen und
Rentiergeweihe. Obwohl als Material nicht wertvoll ist, haben die daraus
geschnitzten Tierfiguren als nördliche Souvenirs doch auch ihren Reiz.
Welchen Wert hat Ihre Jahresproduktion?
1970 produzierten wir Gegenstände im Wert von hunderttausend Rubel, zehn Jahre
später betrug die Summe zweihundertdreißigtausend Rubel.
Der bekannte französische Meeresforscher Cousteau beklagt in einem seiner
Bücher, dass sich keiner um die traditionelle Elfenbeinkunst der amerikanischen
Eskimos sorgt. `Schon das windigste Gekritzel, ein paar ungelenk angedeutete
Linien´, so schreibt Cousteau, ´wird von amerikanischen Aufkäufern als
wertvolle Ritzzeichnung teuer verkauft.´ Wer bestimmt denn bei Ihnen, was
künstlerisch wertvoll ist?
Jedes Sujet muss als Zeichnung eingereicht werden. Ein künstlerischer Rat, dem
unsere besten Elfenbeinkünstler angehören, entscheidet dann über die
Ausführung. Diesem Urteil beuge auch ich mich, kein Künstler, sondern `nur´ ein
Ökonom.
Jedenfalls sehen wir, dass die uralte tschuktschische
und eskimoische Elfenbeinkunst bei Ihnen, Direktor Jakowtschuk, in guten (russischen) Händen liegt.
Im Museum der Knochenschnitzwerkstatt zeigt man uns viele, alles einmalige
Exponate. Jelena Janku erzählt uns zu einigen Motiven
den Inhalt der Märchen. So ist auf einer Brosche das Märchen dargestellt
Wie
eine Menschenmutter zu einem Walrosskind kam:
*
Vor langer Zeit, da hatten ein Mann
und eine Frau einen Sohn. Einmal war es dann so weit, dass der Sohn das erste
mal mit seinem Vater zur Jagd gehen durfte. Als sie schon genug Tiere gejagt
hatten, beugte sich der Sohn zu weit über den Rand einer Eisscholle, fiel ins
Meer und ertrank. Der Mann weinte viele Tränen. Wie fürchtete er sich, nach
Hause zu gehen.
Da kam ihm eine Idee. Oft schon hatte er beobachtet, wie sehr eine
Walrossmutter ihr Junges liebt. Mindestens zwei Jahre behütet sie es, nimmt es
auf den Rücken, wenn es müde ist vom Schwimmen, tätschelt und verhätschelt es.
Er machte sich also auf die Suche nach einem Walrosskind, dessen Mutter
gestorben war. Er irrte langer umher, dann fand er auf einer Eisscholle ein
verlassenes Walrosskind, das schon ganz schwach war. Er nahm es auf und ging
den langen Weg zurück.
Zu seiner Frau sagte er, dies sei ihr Sohn, der böse Geist Kele
habe in verzaubert. Sie solle immer nur zärtlich zu ihm sein, vielleicht würde
er dann wieder zu einem Menschen werden.
Die Frau war froh, ihr Kind endlich wieder bei sich zu haben - in welcher
Gestalt auch immer. Sie behütete es, hätschelte und verhätschelte es - bis sie
gar nicht mehr traurig darüber war, dass ihr vermeintlicher Sohn wie ein
Walross aussah.
*
So phantasievoll die
Motive auch sind, so bewahrt doch fast jeder Elfenbeinkünstler auf der Tschuktschen-Halbinsel die uralte Tradition, auf der einen
Seite des Walrosshauers das Leben der Meerestierjäger darzustellen und auf der
anderen Seite das Leben der Rentierzüchter in der Tundra. So ist auf der
Meerestierseite eines Walrosselfenbeinzahnes das Märchen dargestellt
Wie ein Walkind und ein Küstensohn Brüder
wurden.
*
Es ist lange her, da bat ein Wal eine schöne Küstenfrau, sie möge mit ihm
aufs Meer hinausgehen. Der Küstenfrau gefiel der stattliche Wal sehr. Aber da
sie zu Hause einen Mann und einen Sohn hatte, musste der Wal sie sehr lange
bitten. Nach einem Jahr brachte die Frau ein Walkind zur Welt. Irgendwann aber
bekam sie Sehnsucht nach ihrem Menschenkind. Da erlaubte der Walmann ihr, nach
Hause zurückzukehren. Mann und Sohn der Küste waren sehr froh über ihre
Rückkehr. In jedem Frühjahr und Sommer kam das Walkind ganz nah an die
Küstensiedlung. Da immer viele Meerestiere bei ihm waren, kehrten die
Küstenmenschen nie mehr ohne Beute heim. Jedes mal, wenn sich das Walkind dem
Ufer näherte, ging der Küstensohn zu ihm. Einer zeigte dem anderen viele Spiele.
Beide wussten, dass sie Brüder waren. Eines Tages töteten
neidische Menschen der Nachbarsiedlung den Waljungen. Die Küstentschuktschen
trauerten sehr lange um den getöteten Waljungen, der eine Menschenfrau zur
Mutter gehabt hatte.
*
Auffallend viele tschuktschische und eskimoische Märchen erzählen vom innigen Zusammenleben von
Mensch und Tier. So ist auf einer Tabakpfeife das Märchen dargestellt
Wie sich ein Eisbärenmädchen in einen
Jägermenschen verliebt.
*
Einst lebte eine Mutter mit ihrem Sohn zusammen, der ein Jäger war.
Eines Tages ging der Sohn zur Jagd. Eine Bärin, die am Meer umherstreifte, sah
ihn schon von weitem. Um ihn nicht zu erschrecken, schlüpfte sie aus ihrer
Bärenhaut. Von diesem Tag an trafen sich die Mädchen- Bärin und der junge Jäger
jeden Tag. Schon bald nahm der Jäger die Mädchen-Bärin mit nach Hause, und alle
drei lebten friedlich miteinander. Schließlich aber fiel der Mutter auf, dass
die Frau ihres Sohnes kein Fleisch aß, sondern nur Fett und Speck. Da ahnte
sie, dass diese Frau eine Bärin war. Als der Sohn einmal das Haus verließ,
jagte die Mutter die Bärin fort. Der Sohn war sehr traurig, als er hörte, dass
seine Frau und die beiden Kinder nicht mehr da waren. Sogleich ging er sie
suchen. Er fand sie alle bei den Brüdern seiner Frau. Die Bärenbrüder wussten
schon, dass der Mann ihrer Schwester ein Mensch war. Weil ihre Schwester diesen
Mann so gern hatte, erlaubten sie ihm, für immer bei ihnen zu leben.
*
Übersetzung
der drei Märchen aus dem Russischen von Raisssa Netschajewa,
gesammelt von Gisela Reller
Von der Knochenschnitzwerkstatt
aus wollen wir noch die Polarstation besuchen. Auf dem Weg dorthin kriegen uns
zwei Grenzsoldaten am Rockzipfel zu fassen. Ganz außer Atem bitten sie um
unsere sofortige Umkehr. Der Hubschrauber stehe schon startbereit, Nebel in Sicht!
Da machen wir eine zackige Kehrwendung und flitzen durch Uëlen,
als sei Kele, der legendäre böse Geist der
Tschuktschen und Eskimos, hinter uns her. Sofern mir Atem und Beine versagen
wollen, stelle ich mir flugs die Leidensmiene unseres Chefredakteurs vor wegen
`so einer kleinen Verspätung´ von, sagen wir achtundzwanzig Tagen."
"Der Tschuktsche achtet körperliche
Dienst-leistungen, wenn er nur genug zu essen bekommt, für gering und in
seiner Freude über den kargen Lohn an Tabak, Messern und anderem vergißt er,
daß er den ganzen Sommer verloren hat, in dem er für den kommenden Winter
hätte sorgen können."
Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und
Arthur Krause (deutscher Naturforscher und
Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920)
in:
Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882
Nördlichste
russische Hafenstadt
(LESEPROBE
aus: "Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Von Lawrentija
fliegen wir mit einer IL 14 nach Anadyr. Hier haben wir nur auf dem Flugplatz
Zeit, von unserem lieben Tolja Abschied zu nehmen
(der uns wie ihm gleichermaßen schwerfällt). Schon eine Stunde später fliegen
wir weiter nach Pewek - Moskau schon eintausend
Kilometer und eine Zeitzonenstunde näher.
Seit 1981 gibt es in der Sowjetunion neue Zeitzonengrenzen. Wegen ihres
riesigen Territoriums ist die Festlegung einer Zeitrechnung nach Zeitzonen für
die Sowjetunion besonders wichtig.
Unser Erdball ist in 24 Zeitzonen eingeteilt, über elf davon erstreckt sich das
Sowjetland. Bereits 1919 waren auf der Grundlage der damals bestehenden
Verwaltungsstruktur sowie des Weltzeitzonensystems Zeitzonen festegelegt
worden; in den unerschlossenen Gebieten des Fernen Ostens und hohen Nordens richteten
sie sich nach dem Verlauf von Flüssen, Wasserscheiden oder Längengraden.
Diese Einteilung von 1919 (mit einer Verschiebung von 193 Grad) entspräche nun
nicht mehr den - vornehmlich ökonomischen - Erfordernissen. Große
sozialökonomische Veränderungen waren unter der Sowjetmacht vor sich gegangen,
neue territoriale Produktionskomplexe hatten sich herausgebildet, die
Bevölkerung Sibiriens hatte beträchtlich zugenommen, neue Städte waren
entstanden. Dadurch veränderten sich auch die ökonomischen, sozialen und
kulturellen Beziehungen zwischen den einzelnen Landesteilen. Und so erwies es
sich als unzureichend, weiterhin formal nur von dem internationalen
Zeitzonensystem und von der Geographie auszugehen. Wichtig war, auch die
Arbeitsbedingungen des Verkehrs- und Nachrichtenwesens zu berücksichtigen und
den günstigsten Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen. Besondere Bedeutung
haben die Zeitzonen für das einheitliche Energiesystem der UdSSR. Sie
ermöglichen es, die Höchstbelastungen landesweit zu steuern.
Auch weiterhin bildet das internationale System die Grundlage für die
Einteilung des Landes in Zeitzonen - nach Möglichkeit sind die bestehenden
erhalten geblieben. Veränderungen machen sich in erster Linie dort nötig, wo
neue Gebiete erschlossen worden sind, neues Leben entstanden ist - zum Beispiel
auf Tschukotka, das seit 1981 von einer zusätzlichen
Zeitzone durchschnitten wird. In der Hafenstadt Pewek
ist es nunmehr eine Stunde früher als auf der Tschuktschen-Halbinsel.
Die arktische Siedlung Pewek wurde 1930 gegründet,
1969 erhielt sie Stadtrecht. Die erste Zinngrube in Pewek
(inzwischen gibt es fünf) leitete die industrielle Erschließung Tschukotkas ein.
In Pewek - der Hafenstadt hinter dem Polarkreis -
herrscht zweiundvierzig Tag lang ununterbrochen Polarnacht, fünfzig Tage lang
ununterbrochen Polartag, der nächste Baum wächst erst dreihundert Kilometer
südlich. Nach Pewek führen weder Eisenbahnschienen
noch Autostraßen. Die einzige (eisige) Lebensader dieses Gebietes ist die
Schiffsverbindung durch das Nördliche Eismeer - der Nördliche Seeweg.
Als Nordöstliche Durchfahrt oder Nordostpassage, in den letzten Jahrzehnten als
Nördlichen Seeweg bezeichnet man den Seeweg vom Europäischen Nordmeer zum
Stillen Ozean längs der Nordküsten Europas und Asiens nach dem Beringmeer. Er
misst von Archangelsk bis zur Beringstraße rund 6 500 Kilometer, bis
Wladiwostok 11 250 Kilometer (während der Seeweg von Archangelsk nach
Wladiwostok durch den Suezkanal rund 24 800 Kilometer lang ist).
Mit der Erschließung des Nördlichen Seeweges ist ein Jahrtausende währendes
gewaltiges Forschungswerk verbunden.
Hunger und Durst, totale Erschöpfung, ständiger ermüdender Kampf gegen die
grausame Kälte der arktischen Nacht, das monotone Leben an Bord monatelang im
Eis festliegender Schiffe, die ständige Ungewissheit, ob man je die Heimat
wiedersehen würde, brachten so manchen Arktisforscher um Verstand und Leben,
machten ihn zum Mörder oder trieben ihn zum Selbstmord. In vielen Fällen wird
das Schicksal ganzer Expeditionen, die sich hartnäckig den Weg nach Norden
bahnten, für immer ein unlösbares Rätsel bleiben.
Schon dreitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung machte sich der griechische
Astronom, Geograph und Mathematiker Pytheas auf den
Weg nach Norden. Irgendwo im Ozean - bis auf den heutigen Tag weiß niemand, wie
weit nach Norden die Griechen damals vorgedrungen sind - wird er mit seinen
Gefährten vom Treibeis eingeschlossen. `Dort, wo es die uns bekannten drei
Grundelemente Erde - Luft - Wasser nicht gibt, sondern nur ein wunderliches
Gemisch, worauf der Mensch weder gehen noch mit einem Schiff segeln kann, dort
muss die dem Menschen erkennbare Welt enden.´ Die Wikinger, Erich der Rote,
Marco Polo, John und Sebastian Cabot (der um 1500
schon den Wal als Quelle des Reichtums entdeckte), Willoughby, Chancelor, Davis, Barents,
Hudson, Baffin, Moskwitin, Deshnjew,
Bering, Tschitschagow, Franklin, Wrangel, Cook, Stefansson... Namen, von denen viele zu geographischen
Begriffen wurden. Namenlos blieben die vielen Tschuktschen und Eskimos,
Jakuten, Nenzen, Jukagiren,
Ewenken, die so manchem Forscher (oder Abenteurer)
den Weg wiesen oder durch Unterkunft und Essen das Leben retteten.
Die eigentliche Geschichte der Jahrhunderte lang unbezwungenen,
gefahrenreichste Schiffsroute der Welt beginnt mit dem schwedischen Forscher Nordenskiöld:
1878-1879 Fahrt der `Vega´ mit Adolf Erik
Freiherr von Nordenskiöld - mit einer Überwinterung
an der Eismeerküste; oft kommen Tschuktschen an Bord.
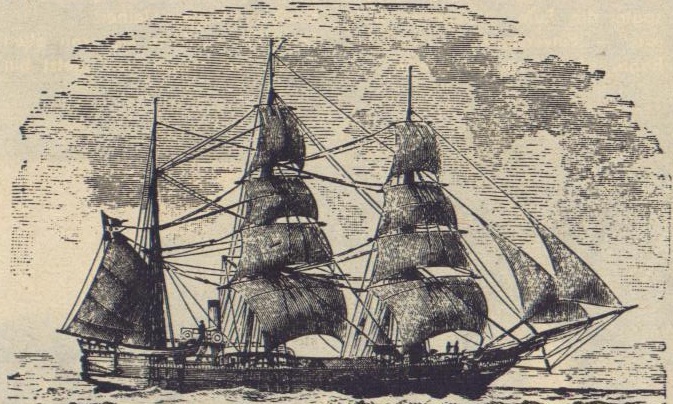
Nachdem Adolf Erik Nordenskiölds
„Vega“ unter vielen Gefahren die Nordküste Sibiriens umfahren hatte, fror sie
Ende September 1878 nordwestlich der Beringstraße
ein und konnte erst am 18.
Juli 1879 ihre Reise fortsetzen.
Zeichnung aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
1893-1896 Fridjof Nansen driftet mit der `Fram´ über das Polbecken.
1899-1901 Der russische Eisbrecher `Jermak´,
das erste Schiff der Welt, das zum Durchbrechen dicker Eisschichten in der Lage
war, erreicht unter Admiral Makarow Spitzbergen und Nowaja Semlja.
1914 Der russische Flieger Nagurski unternimmt
die ersten erfolgreichen Arktisflüge.
1928 Durch einen Beschluss des Rates der Volkskommissare der UdSSR wird
die `Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg´ gegründet. Ihre Aufgabe: den Nördlichen
Seeweg vom Weißen Meer bis zur Beringstraße endgültig festzulegen, ihn in
möglichst einwandfreiem Zustand zu halten und die Sicherheit der Schifffahrt zu
gewährleisten. - Der sowjetische Eisbrecher `Sibirjakow´
meistert die Nordöstliche Durchfahrt ohne Überwinterung.
1933-1934 `Die Tscheljuskin´ wird an abgelegener Stelle vom Eis
zerdrückt, die gesamte Besatzung durch Flugzeuge gerettet; Eskimos mit
Hundeschlitten weisen den Weg.
1934 Der Eisbrecher `Litke´ meistert die
Durchfahrt ohne Überwinterung. An Bord befinden sich Exemplare der ersten tschuktschischen Fibel.
1937 Erste Flugzeuglandung am Pol. Errichtung der Station `Nordpol 1´
durch den sowjetischen Forscher Papanin.
1941-1945 Überführung von Kriegsschiffen von Ost nach West und
umgekehrt.
1953 Beginn des regelmäßigen Passagierschiffsverkehrs.
1959 Der erste Atomeisbrecher, die `Lenin´, wird in Dienst gestellt.
1975 Der zweite Atomeisbrecher, die `Arktika´,
beginnt mit dem Geleit von Frachtern während der Polarnacht.
1977 Am 17. August erreicht die `Arktika´ als
erstes Überwasserschiff den geographischen Nordpol.
1978 Der dritte Atomeisbrecher, `Sibir´, wird
in Dienst gestellt; auf einigen Abschnitten des Nördlichen Seeweges kann so die
Schifffahrtsperiode bereits auf zehn Monate im Jahr ausgedehnt werden.
1982 Operation `Arktis 82´ - es werden 136 000 Tonnen mehr Güter nach Tschukotka geliefert als 1981.
1983 Es kommen Spezialfrachter eines neuen Typs der `verstärkten
Eisklasse´ zum Einsatz. Das erste Schiff dieser Serie, die `Igarka´,
absolviert im Frühsommer ohne Eisbrecherbegleitung eine Nonstopreise von Leningrad
bis Pewek.
Oktober 1983 Drei Wochen lang wird bei extremen Wetterbedingungen im
Ostabschnitt des Nördlichen Seeweges ein äußerst schwerer Kampf um siebzig im
arktischen Eis eingeschlossene Schiffe geführt. Mit Hilfe des Krisenstabes in Pewek und durch konzentrierten Einsatz der gesamten
Eisbrecherflotte, vor allem der atomar angetriebenen Schiffe `Sibir´ und `Leonid Breshnew´ mit
je 75 000 PS sowie der `Lenin´ mit 44 000 PS, kann eine Katastrophe abgewendet
werden. - Die Arktisflotte erhält einen völlig neuen Schiffstyp:
Leichtertransporter. Der erste nimmt 82 Leichter mit je 380 Tonnen
Tragfähigkeit an Bord, die am jeweiligen Bestimmungsort zu Wasser gelassen
werden und dann selbständig ihre Reise, zum Beispiel auf kleinen Flüssen,
fortsetzen. - In Kertsch beginnt inzwischen der Bau
eines atomgetriebenen Leichterschiffes.
Anfang des 21. Jahrhunderts Der Nördliche Seeweg soll die Baikal-Amur-Magistrale (BAM) beim Güterumschlag noch
übertreffen!
Das
Nordpolarmeer
ist mit 14 Millionen Quadratkiolometern zwar der kleinste Ozean, aber
immer noch fast so groß wie Russland oder anderthalbmal so groß sie die
USA. Seine Festlandsockel
nehmen im Verhältnis mehr Raum ein als bei jedem anderen Ozean, was
einer der Gründe ist, warum es schwer ist, sich auf Hoheitsgewässer zu
einigen.
Routen, die früher von wagehalsigen Expeditionen erkundet wurden, werden heute
von Schiffen im Linienverkehr befahren - wenn auch noch immer nicht ganz
gefahrlos, wie die dramatischen Wochen im Jahre 1983 erneut bewiesen. Der Hafen
von Pewek, unser Ziel, wird von Schiffen angelaufen,
die entweder in ostwestlicher Richtung von Wladiwostok nach Tiksi
oder von Murmansk im europäischen Teil der Sowjetunion nach Wladiwostok fahren.
Vor zwanzig Jahren war Boris Fedorowitsch Abakumow in Pewek eingetroffen,
seit fünfzehn Jahren arbeitet er im Hafen, heute als Direktor. Dies hier sein
Monolog während der Hafenbesichtigung: `Von hier aus werden die Güter auf
Flussschiffe verladen und die Kolyma aufwärts weit ins Landesinnere
transportiert, wo sie immer schon sehnsüchtig erwartet werden. Anfangs gab es
hier nur eine einzige Reede, später noch provisorische Anlagen aus Holz. Von
einem eigentlichen Hafen kann man erst seit 1968 sprechen, als der Bau einer
Anlegestelle aus Eisenteilen begann. Auf ewigem Frostboden erbaut, ist sie auf
der Welt ohne Beispiel. Zur Zeit können wir mit Hilfe großer Portalkrane
Frachtschiffe bis zu zehntausend Bruttoregistertonnen innerhalb eines Tages be-
oder entladen. Wir erwarten schließlich nicht nur Güter, sondern wir haben auch
einiges mitzuschicken: Zinn, Gold, Quecksilber...
Während der Navigationsperiode wiegt ein Tag viele Tage auf, da geht es hier
rund im Hafen. Vor zwei Tagen - genau am 19. August - hatten wir schon minus
sechs Grad; seitdem haben die Mückeninvasionen aufgehört. In einer Woche sind
wir weiß! Es gibt Tage, an denen die Geräte nichts mehr registrieren, zum
Beispiel wenn unser Südwind, der `Jushak´, mit
sechzig Metern in der Sekunde durch Pewek stürmt. Wer
an solchen Tagen unbedingt eine Straße überqueren muss, hangelt sich an einem
eigens zu diesem Zweck angebrachten Seil hinüber.
Die Wetterereignisse zweier Jahre sind in meinem Gedächtnis eingegraben: 1973 -
im schönen Sommermonat August - trieb Nordwind das Wasser einen Meter hoch über
die Befestigungen. Dazu krachten große Eisschollen an unsere Schiffe und Krane.
Es war ein unbeschreiblicher Kampf mit einer wild gewordenen Natur. Und 1980 -
im polardunklen Dezember - stürmte unser `Jushak´ so,
dass unsere Krane buchstäblich durch die Luft flogen.
Trotzdem: Ich habe mir vorgenommen, noch zehn Jahre mit dabei zu sein bei der
Erschließung des wahrlich rauen hohen Nordens. Dann allerdings werden wir -
meine Frau arbeitet als Chefingenieur für Normierung im Hafen - zurück in
unsere klimatisch gemäßigtere Heimat reisen. Der hohe
Norden braucht junge Leute - keine Rentner. Nicht umsonst erhalten die
männlichen Nordländer schon mit fünfundfünfzig Jahren und die weiblichen mit
fünfzig Jahren ihr Ruhegeld.
Außer den Früchten unserer Arbeit werden dann unsere hier geborenen Kinder
zurückbleiben. Ihre Heimat ist Tschukotka.´".
Die
erste Durchquerung der Nord-Ost-Passage:
Die waghalsige Expedition
in arktische Gefilde war hervorragend geplant, und beinahe wäre der Schwede Adolf
Erik Nordenskiöld als erstem Menschen in der Entdeckergeschichte
die Durchquerung der
Nord-Ost-Passage gelungen. Doch nur wenige Kilometer vor
den eisfreien Gewässern der Beringstraße
werden die "Vega"
und ihre Mannschaft vom arktischen Winter überrascht und stecken im
meterdicken
Eis fest. Erst ein gutes Jahr später, am
18. Juli 1879, gelingt den
Finnen nach der
lebensbedrohlichen Überwinterung die erfolgreiche Beendigung der Expedition,
die dem Schweden Nordenskiöld zahlreiche Ehrungen
einträgt.
Goldene
Siedlung hinter dem Polarkreis (LESEPROBE aus: "Diesseits
und jenseits des Polarkreises")
"Nun sind wir mit einer AN 24
dreihundert Kilometer gen Süden geflogen - und tatsächlich - Bäume: Waldtundra.
Die Waldtrundra, Grenzbereich zwischen Wald und
Tundra, ist ein Vegetationstyp, der in manchen Gebieten nur eine
verhältnismäßig schmale Zone einnimmt, sich oft aber auch in Nordsüdrichtung
über Hunderte von Kilometern erstreckt.
Den Eindruck, den die Waldtrundra auf Reisende macht,
hat der russische Naturforscher Seroschewski so
geschildert: `Der Wald ist kümmerlich. Vorzeitig gealtert, bedeckt mit bärtigen
Flechten, mit spärlichem gelblichem Grün auf wenigen lebenden Sprösslingen, mit
vertrockneten, oft abgebrochenen Spitzen zieht er sich in einem breiten
trostlosen Streifen längs der nördlichen Waldgrenze hin. Schwächliche Bäume,
vier bis sechs Meter hoch, mit einem Durchmesser von zehn bis fünfzehn
Zentimeter sind mit einer Unzahl von kleinen Ästen, Zweigen und vertrockneten
einjährigen Trieben bedeckt, die längs des Stammes gleichsam wie Dornen
hervorstehen. Die Bäume geben nahezu keinen Schatten und bieten keinen Schutz.
In einem derartigen Wald sieht man überall den Himmel über sich und ringsherum
Lichtungen.´
Wie recht Seroschewski hat. Und doch: Auf uns machen
die Bäume Bilibinos einen heimatlichen Eindruck,
hatten wir doch lange genug überhaupt nichts Hochstämmiges mehr zu Gesicht
bekommen.
Bilibino (25 000 Einwohner), gegründet 1958, ist
benannt nach Juri Alexandrowitsch Bilibin,
der auf dem Gebiet der Lagerstättenlehre arbeitete. Allen anderen Voraussagen
zum Trotz vermutete er im hohen Norden große Goldvorkommen und - entdeckte sie.
Im Magadaner Akademiezentrum hatte uns der
Chefgeologe Mari Jewgenjewitsch Gorodinski
eine geologische Karte von 1922 gezeigt. Der gesamte Nordosten der UdSSR ist da
eine unerschlossene weiße Fläche. Erst 1928 wurde hier unter Leitung des
siebenundzwanzigjährigen Bilibin mit geologischen
Erkundungen begonnen. Juri Bilibin schrieb damals
begeistert von den zu erwartenden riesigen Bodenschätzen des Nordostens. Mehr
als ein Jahrzehnt wurde er dafür ausgelacht. Wie recht der unbeirrbare Mann
hatte! Er strafte dazumal auch die Meinung Lügen, dass niemals Gold und Zinn in
einer Nachbarschaft zu finden seien.
Bis heute sind Magadan und Bilibino
die goldträchtigsten Gebiete der Sowjetunion. `Tschukotka
braucht seine Goldvorkommen´, sagt Magadans
Chefgeologe, `noch lange nicht unter den Scheffel zu stellen.´
Im Lexikon lese ich unter dem Stichwort `Gold´: Zeichen Au (lat.
Aurum); gelb glänzendes Edelmetall, Ordnungszahl 79;
Atomgewicht 196,967; Wertigkeiten III und I, Dichte 19,3 g/cm3; F 1063 Grad C; Kp etwa 2700 Grad C.
Und bei Kolumbus: `Gold - das erstaunlich Ding! Wer es besitzt, ist Herr von
allem, was er wünschen kann.´
Wir halten in Bilibinos Goldgrube `Sewerowostoksoloto´ (`Nordostgold´) das gelb glänzende
Edelmetall für einige Minuten in Händen - es liegt in kleinen und großen
Stücken in einer unansehnlichen weißen Emailleschüssel. Wir werden bei unserer
handgreiflichen Besichtigung streng beäugt von Männern, die ihre Schießeisen
durchaus griffbereit haben.
Wegen der paar Klunkerchen...
Gold gibt es überall: in jedem Boden, jedem Gestein und im Meereswasser. Aber
seine Konzentration ist in den weitaus meisten Fällen verschwindend gering. Im
Durchschnitt enthält eine Tonne Erdrindenstoff etwa vier Milligramm Gold. Das
ist nur ein Tausendstel des Gehalts an Kupfer, Zink und Blei. Und wie mühsam
ist die Goldgewinnung! Noch heute. Trotz Goldbaggers, Hydromonitoren, Saug- und
Greifbaggers, Planierraupen und anderen Maschinen.
Andrej Anikin, Professor am Moskauer Institut für
Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen, schreibt in seinem Buch `Gold´:
`Alles bisher gewonnene Gold würde in einem Würfel von siebzehn Meter
Seitenlänge oder im Zuschauerraum eines mittleren Filmtheaters Platz haben.´
In der Grube `Sewerowostoksoloto´ wird das Gold durch
das älteste Verfahren, durch Auswaschen, gewonnen. Die Waschperiode für die
Goldgewinnung beträgt auf Tschukotka nur etwa
dreieinhalb Monate, weil ja nur gewaschen werden kann, wenn Wasser fließt.
`Unser goldener Tagebau ist bereits zwanzig Jahre alt´, sagt der Oberingenieur
Gennadi Wladimirowitsch Nagul,
`er wird langsam ärmer. Aber unsere Geologen haben schon ein neues Vorkommen
entdeckt: Berggold, das uns sommerunabhängig macht.´
Übrigens: `Die paar Klunkerchen´ in der unansehnlichen weißen Emailleschüssel repräsentierten
einen Wert von - einer Million Mark! Nicht auszudenken, was man sich dafür
alles kaufen könnte. Doch ich halte es lieber ganz schnell mit Cervantes: `Gold
bringt immer Sorgen, ganz gleich, ob wir es haben oder ob es uns fehlt.´ Oder
mit Pablo Neruda: `Wo es Gold gibt, gibt es auch Streit...´ Oder mit Puschkin:
`Es sieht so wenig aus. / Doch wie viel Mühe, Sorge, Not der Menschen, /
Gebete, Flüche, Tränen und Betrug...´"
Es
gibt noch genug
Gold auf Tschukotka! Das Gold- und Kupferfeld Pestschanka auf der
Tschuktschen-Halbinsel im äußersten Nordosten
Russlands dürfte zum weltweit fünftgrößten Vorkommen dieser Art werden. Das
behauptete der Gouverneur des Gebiets Tschukotka,
Roman Kopin, im Februar 2011 bei einem Treffen mit
Regierungschef Wladimir Putin in dessen Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo.
"Die Lagerstätte, in der Experten bis zu 1 600 Tonnen Gold und etwa 27
Millionen Tonnen Kupfer vermuten, wird seit zwei Jahren erkundet. Einige
Investoren finanzieren diese Arbeiten." - Der Gouverneur teilte mit, dass
auf der Tschuktschen-Halbinsel durchschnittlich 25
Tonnen Gold im Jahr gewonnen werden. Das bislang
beste Resultat - 30 Tonnen -
sei 2009 registriert worden. In der Region sei Russlands größter Goldförderer
"Polus Soloto"
aktiv.
Von
der Fettschüssel zum Atomkraftwerk
(LESEPROBE aus: "Diesseits und jenseits des Polarkreises")
"Im Wohnzelt der Tschuktschen und Eskimos war Jahrhunderte lang einzige
Licht-, Wärme- und Kochquelle eine Schüssel aus Stein, funktionstüchtig mit
Feuerstein und Tundramoos, getränkt mit Rentiertalg
oder Seehundstran. Die Sorge um diese Fettschüsseln
oder Tranlampen oblag ausschließlich den Frauen. Jede
verheiratete Frau musste ihre eigene `Nanek´ sogar
dann haben, wenn einige Familien in einem Fellzelt zusammen wohnten. Neben den
Gebrauchslampen existierte noch eine sehr kleine Lampenart, die zu
Begräbniszeremonien benutzt wurde. Einer Toten lege man neben anderen
Haushaltsgegenständen unbedingt auch eine Tranlampe
mit ins Grab.
`Wie eine Frau ohne Lampe...´ ist heute noch eine
gebräuchliche Redewendung für einen Menschen, der zu nichts nütze scheint.
Ursprünglich, so behauptete der russische Erforscher der Kulturen des Nordens
Wladimir Bogoras (1865 bis1936)
diente die Lampe nur Beleuchtungszwecken; denn die Jarangas
[Wohnzelte] der Tschuktschen und Eskimos hatten keine Fenster. Licht, so meinte
er, galt bei Tschuktschen und Eskimos mehr denn Nahrung oder Wärme. Wurden
nicht genügend Tiere erlegt, herrschten Hunger, Kälte und Dunkelheit. Trotzdem
sprachen Tschuktschen und Eskimos nie davon, dass eine Hungersnot geherrscht
habe, sondern sie sagten grundsätzlich, dass es furchtbar dunkel gewesen sei.
Auch in vielen Märchen gibt es Wendungen, die die Ansicht Bogoras´
bestätigen. So heißt es in einem eskimoischen
Märchen: `Es gab keine Meerestiere, und die Lampen erloschen...´ Oder in einem tschuktschischen Märchen: `Seehunde wurden erlegt, und das
Feuer in den Lampen stieg wieder empor...´
Mit der Sowjetunion erst kam `Kergytschyn´ - `Lichtheit´ - auch ans `Ende der Welt´.
Heute gibt Tschuktschen, Eskimos und Zugereisten Licht und Wärme das erste
Atomkraftwerk hinter dem Polarkreis. Auf ewigem Frostboden erbaut, befindet es
sich in Bilibino, dem Ort auf Tschukotka,
der von den Brennstoffquellen am weitesten entfernt ist. Mit sechs Etagen ist
das Atomkraftwerk das höchste Gebäude Tschukotkas und
das einzige mit einem Lift. Du wirst hier in einen weißen Kittel gehüllt,
bekommst eine weiße `Bäcker´mütze verpasst und musst
in Hausschuhe schlüpfen. Das Atomkraftwerk von Bilibino
- das wird dir unmissverständlich klargemacht - gilt als das sauberste der
ganzen Sowjetunion; es gehört zur jüngsten Generation.
Durch das Kernkraftwerk führt uns German Jefimowitsch
Soldatow. Er stammt aus Moskau, begann hier als
Meister, wurde dann Werkstattleiter, später Chefingenieur und ist jetzt der
Direktor des nördlichsten Kraftwerkes der UdSSR. `Und wenn auch nicht als Tschuktsche oder Eskimo´, sagt er, `so fühle ich mich nach
elf Polarwintern doch schon als echter Nordländer.´
Ein zaristischer Inspektor hatte 1916 geschrieben, dass er eine wirtschaftliche
Entwicklung der Tschuktschen-Halbinsel für unmöglich
halte, da unter den Bedingungen des hohen Nordens keine `gebildete
Menschenseele´ freiwillig aus Russland herkommen würde. German Soldatow ist einer von Hunderttausenden `hoch gebildeter Freiwilliger´, die aus dem ganzen Sowjetland
hierhergekommen sind. `Unser Atomkraftwerk war Komsomolgroßbaustelle.
Allein zweitausend Jugendliche kamen 1974 freiwillig aus allen Teilen der
Sowjetunion.´
Das Kernkraftwerk gewährleistet die Energieversorgung der Tschuktschen-Halbinsel
und Kolymas, gibt also Tausenden Familien Licht und
Wärme in `atombeheizten´ Wohnungen, Elektroenergie für die Industrie, vor allem
für die Förderung im Goldtagebau des jüngsten Industriezentrums Bilibino. Darüber hinaus ist es aber das erste
Kernkraftwerk, das Industrie- und Haushaltsstrom liefert. Bald wird die
Bevölkerung das ganze Jahr über mit frischem Gemüse versorgt werden können,
weil das Kernkraftwerk auch die nötige Wärme für die schon projektierten
Treibhäuser spenden wird.
Ich frage German Soldatow, wie denn die Bevölkerung
zu dem Atomkraftwerk stehe. `Man nennt unser Kernkraftwerk, das auch mit
Anlagen aus der ČSSR, Ungarn und der DDR ausgestattet ist, hier liebevoll
`Atomkamin´. Keiner, der `in der Heimat des Winters´ heute noch in
frostklirrenden Unterkünften hausen möchte. Sogar die Kinder in Bilibino freuen sich - sie haben ihre Schwimmhalle! Früher
brachten hier sechsunddreißig Kesselhäuser Licht und Wärme. Bei ungünstigem
Wind stand ein regelrechter Smog über unserer Goldgräbersiedlung. Für den hohen
Norden haben Kernkraftwerke durchaus eine Perspektive. Um unsere achtundvierzig
Megawatt in einem Kohlewärmekraftwerk zu erzeugen, wären 2,5 Millionen Tonnen
Kohle im Jahr nötig. Der Transport einer einzigen Tonne Brennstoff in unsere
entlegene Gegend kostet einhundert bis zweihundert Rubel. Den Atombrennstoff
aber bringt ein einziges Flugzeug für vier Jahre`.
Wie lange wird German Soldatow - um mit dem
Forschungsreisenden Amundsen zu sprechen - noch `Polaroptimist´ bleiben? -
German Soldatow überlegt: `Wie lange? Solange ich
mich jung und gesund genug fühle, den Polarunbilden zu trotzen.´
Während der Besichtigung der Schaltzentrale, der Reaktorhalle, der
Messkontrollräume... schaue ich in viele Gesichter, aber ein tschuktschisches oder eskimoisches
ist nicht dabei.
`Arbeiten denn keine Angehörigen der Urbevölkerung in Ihrem Werk?´ frage ich. -
`Doch, ein Tschuktsche: Wladimir Äm.
Leider können Sie ihn nicht sprechen, wir haben ihn gerade zur Weiterbildung
nach Moskau delegiert.´
Als ich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringe, dass nur ein
Einheimischer `Kernkraftwerker´ ist, sagt German Soldatow:
`Nur? Sagen Sie besser schon. Noch vor einem halben Jahrhundert
hatten die angestammten Bewohner Tschukotkas
urgeschichtliche Lebensgewohnheiten.´"
Vor
und
nach
dem Zerfall der Sowjetunion: "Im Buch Unna (1997)
von Jury Rytchëu spielen nur machtgierige Funktionäre
eine Rolle und stockbesoffene Einheimische, "die sich bis zur
Bewusstlosigkeit betranken, sich dann in Gräben, Hinterhöfen und Müllgruben
wälzten". Nicht ohne Grund, das wird aus dem Buch klar, sondern weil viele
Rentierzüchter arbeitslos geworden sind, ehemalige Meerestierjäger selbst
keine Jagd mehr auf Wale machen dürfen,
traditionelle Fischer, weil
zwangsumgesiedelt, nicht mehr fischen können, weil sich das Meer
nicht mit umsiedeln ließ. Ich weiß, dass es zu ungezählten Selbstmorden kam,
zu
fürchterlichem Alkoholismus. Aber ich sah bei meinem Aufenthalt auf dem
exotisch-schönen
Tschukotka durchaus auch
normale
Einheimische, die sowohl ihrer traditionellen Arbeit als
Rentierzüchter
nachgingen als auch moderner
Tätigkeit als Goldwäscher oder sogar als
geschätzte Mitarbeiter
des Atomkraftwerks von Bilibino.
Aber in Unna wird alles an der Sowjetmacht verteufelt,
auch die Geburt
einer eigenen Schriftsprache von Tschuktschen und
asiatischen Eskimos, auch die
Quote, mit der Vertreter der einheimischen Bevölkerung eines
Studienplatzes
sicher sein konnten, auch die Versorgung über den Nördlichen Seeweg mit allem
was die Bevölkerung Tschukotkas benötigte. Es ist
wahr, die Rundum-Fürsorge durch den Staat zerstörte
viele tschuktschische und eskimoische
traditionelle Lebensgewohnheiten.
Als die Sowjetunion unterging, und kein Geld
mehr für die kleinen Nordvölker da war, wussten
viele Einheimische schon nicht
mehr, wie sie sich traditionell selbst ernähren können, hatten viele verlernt,
sich mit dem zu behelfen, was das Tschuktschenland
durchaus in reicher Fülle bietet..." Ich habe
in Pewek
selbst zugesehen, wie für die kleinen Nordvölker vom
Kugelschreiber über
Toilettenpapier bis zum Kühlschrank alles aus dem europäischen Teil Russlands
hergeschafft wurde..."
Aus der Rezension von Gisela Reller in www.reller-rezensionen.de

Schachturnier in der
Tschuktschen-Tundra.
Foto aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
Neben
meinen Buchveröffentlichen habe ich viele Beiträge über die Völker der
ehemaligen Sowjetunion in der Illustrierten FREIE WELT veröffentlicht bzw. in
anderen Medien. Hier einige Beiträge (Auswahl), die gute Ergänzungen zu dem
bereits Dargestellten bilden:
Aus FREIE WELT 23/1983:
Mein Besuch bei dem ersten Schriftsteller der Tschuktschen, bei Juri Rytchëu
"Als wir FREIE WELT-Reporter
1980 die ersten ausländischen Journalisten waren, die zu Sowjetzeiten das Tschuktschenland
bereisten, war der tschuktschische Schriftsteller
Juri Rytchëu hier zwar in aller Munde, selbst aber
`im Augenblick´ nicht anwesend. Im Augenblick? Juri Rytchëu wohnt seit 1948 in Leningrad, elftausend Kilometer
entfernt von seinem Geburtsort Uëlen, dem
allerletzten besiedelten Landzipfel der Sowjetunion. Dort besuche ich ihn drei
Jahre später. Trotz der räumlichen Trennung ist der Tschuktsche
Juri Rytchëu ein Landsmann geblieben. Warum?
Vielleicht, weil all seine Bücher das arktische Leben Tschukotkas
schildern; seine Helden haben hier ihre Vorbilder. Vielleicht, weil er all die
Jahrzehnte Jahr für Jahr zu Besuch hierherkommt; im Ort Providenija
- mit höchstens 40 Minusgraden die Klimaperle Tschukotkas
- hat er sich ein Haus gebaut. Vielleicht weil einer seiner Söhne mit
tatarischer Frau und vierjährigem Sohn hierhergezogen ist; denn `Vater
erzählte so oft und so viel von Tschukotka, dass ich - meiner Nationalität nach Tschuktsche
- in der angestammten Heimat des Tschuktschenvolkes
leben wollte.´ Ganz sicher sehen die Tschuktschen und die asiatischen
Eskimos Juri Rytchëu unabdingbar als einen
der ihren an, weil es seine an Verstand und Herz appellierenden Geschichten
sind, die in aller Welt Verstehen und Zuneigung weckten für zwei am `Rande der
Welt´ lebende kleine Völker, deren Sitten und Bräuche Pelzhändlern,
Forschungsreisenden, zufällig hierher verschlagenen Schiffbrüchigen den Atem
stocken ließ. (…) Juri Rytchëus Bücher von dem
allmählichen Aussterben der Tschuktschen und asiatischen Eskimos vor der Großen
Revolution und von dem neuerwachten Leben danach sind in über dreißig Sprachen
übersetzt: ins Deutsche, Englische, Mongolische, Tschechische, Polnische,
Indische, Finnische, Japanische, Chinesische, Französische, Spanische,
Dolganische, Ungarische...
Hast du das Glück, Gast Juri Rytchëus in seiner
Wohnung auf dem Leningrader Suworowprospekt zu sein,
so ist unverkennbar, dass aus dem richtigen Tschuktschen ein richtiger
Großstädter geworden ist. Juri Rytchëu wurde am 8.
Mai 1930 in einer Jaranga aus Walroßfellen
geboren, in der Familie eines Meerestierjägers. `In meiner frühen Kindheit,
erzählt er uns, ´erschien mir die Jaranga durchaus
nicht kümmerlich. Sicher - so dachte ich - wäre es schön und aufregend, in
einem hölzernen Haus zu leben mit Fenstern, einzelnen Räumen und Betten auf
Beinen - dennoch verlor in meinen Augen die Jaranga
nichts von ihren Vorzügen. Ich kam gar nicht darauf, das Fehlen von
Wasserleitung, Wasserspülung und elektrischem Licht als Mangel anzusehen.´ Doch
dann als Schüler war ihm jeden Morgen, wenn er die Jaranga
verließ, als schritte er über ein Jahrtausend hinweg.
`Ich betrat eine andere Welt, die Welt des Wissens, der Bücher, die Welt der
Zukunft. In jener Welt schienen mir allerdings weder eine Jaranga
noch die alten Zaubergesänge Platz zu haben, die auch damals noch alljährlich
vorgetragen wurden, um gutes Wetter, einen vielköpfigen Zug der Walrosse oder
andere lebensnotwendige Gaben der Natur zu erbitten.´ Als sich die Piloten Timofej Jalkow und Dmitri Tymnetagin als erste Tschuktschen in den Himmel erhoben,
schienen auch Juri Rytchëu Flügel gewachsen zu sein.
Wie anders wäre es zu erklären, dass der Sechzehnjährige, nie vom entferntesten Punkt des asiatischen Festlandes weggewesen,
bei der Vokabel Universität daran zu denken wagte, eine solche selbst zu
besuchen...
`Es war am 26. Juni 1946´, sagt er, `als ich mein Uëlen
verließ, um nach Leningrad zu gehen. Vom Strand weg wanderte ich einige
Kilometer über festes Eis bis zum Rande des offenen Wassers, wo mich ein
Eskimo-Boot erwartete. Unter Segel verließen wir das Eismeer und fuhren in den
Bereich des Pazifischen Ozeans. Klar zu sehen in der Beringstraße die
Inselgruppe der Großen und Kleinen Diomeden - die
einen sowjetisch, die anderen US-amerikanisch.
Mehr als zwei Jahre brauchte Juri Rytchëu, um zur
heißersehnten Universität nach Leningrad zu kommen. In der Eskimosiedlung Naukan war er - um seinen Lebensunterhalt zu sichern - auf
Walrossjagd gegangen, im Dorf Lawrentija hatte er die
Fassaden der allerersten Steinhäuser getüncht, im Hafen der Prowidenija-Bucht
war er Dockarbeiter gewesen. In Tschukotkas
Hauptstadt Anadyr hatte man den Lernbesessenen über ein Jahr lang festgehalten,
damit er in einem Lehrerbildungsseminar notdürftig Russisch lernen konnte.
`Es ist´, glaube ich, ´beinahe unmöglich, sich in meine damaligen Gefühle und
Ängste hineinzuversetzen. Was sah, machte, aß, trank ich damals alles zum
ersten Mal. Nie vergesse ich, nun schon außerhalb Tschukotkas,
den ersten Biss in einen Apfel, den ersten Anblick eines Zuges, die erste
Straßenbahn, den ersten Baum... Leningrad, das Ziel meines Bildungstraumes,
erreichte ich am 4. November 1948. Da war ich neunundzwanzig Monate von zu
Hause weg!´
In Leningrad angekommen, hatte er dieses Erlebnis:` Ich machte mich beklommenen
Herzens direkt auf den Weg zur Universität. Der Tag neigte sich schon dem Ende
zu, irgendwo hinter den Häusern versank die Sonne. Hinter der Glastür der
Universität stand ein bärtiger alter Mann, er trug eine mich beeindruckende
Uniform. Das musste zumindest ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften
sein! Behutsam klopfte ich an die Tür.´ - `Sind sie ein Abiturient (in der
Sowjetunion Teilnehmer der alljährlich stattfindenden Aufnahmeprüfungen)?´,
fragte er in barschem Ton. - `Nein´, antwortete ich, `ich bin ein Tschuktsche.´ - `Da fiel vor meinen fassungslosen Augen die
prächtige Tür mit einem Knall ins Schloss.´
Meine Begegnung mit dem Pförtner, den ich für einen Akademiker gehalten hatte,
war noch oft Anlass zur Heiterkeit. Später erzählte ich meinen erwachsenen
Kindern davon und von der ungemütlichen Nacht, die ich, weil ich nicht wusste,
was ein Abiturient ist, auf einer Bank an den Ufern der Newa
verbringen musste...´
Als Juri Rytchëu noch kein Jahr in Leningrad war,
lernte er ein Mädchen kennen: die Leningraderin Galina [Galja],
eine Russin, achtzehn Jahre alt. Er selbst war gerade neunzehn geworden...
Er: `Damals fühlte ich mich inmitten der lärmerfüllten großen Stadt mit ihren
himmelhoch ragenden Häusern schrecklich einsam.´
Sie: `Und ich hatte während der Leningrader Blockade Mutter, Vater, ja, alle
Angehörigen verloren.´
Im Dezember 1949 schon heirateten die beiden Verwaisten, die nichts rein gar
nichts besaßen außer ihrer tschuktschisch-russischen Liebe.
Er: `Damals begann ich neben meinem Studium der Journalistik über mein Volk zu
schreiben: Gedichte, Kurzerzählungen...´
Sie: `Juri wurde am Anfang selten gedruckt. Aber wenn er mal Honorar bekam,
dann wurden alle Bekannten und Nachbarn zu Tisch geladen. Ich hatte meine liebe
Mühe, Juris tschuktschische Gastfreundschaft zu
bremsen, vor allem, als inzwischen unsere drei Kinder - zwei Söhne und eine
Tochter - geboren waren.
Schwer, sehr schwer hatten es die beiden damals - bis ab Mitte der fünfziger
Jahre Juri Rytchëu fast Jahr für Jahr ein Buch
schrieb - und gedruckt wurde."

Zum Interview in Juri
Rychëus Leningrader Wohnung, schreibend:
Gisela Reller,
begleitet von Raissa Netschajewa, Mitarbeiterin im Moskauer FREIE WELT-Büro.
Alle
Bücher Juri Rytchëus, der 2008 verstorben ist, sind im
Zürcher Unionsverlag erschienen.
Foto: Detlev Steinberg
"Trotzdem wir in der Nacht einen großen
Teil unserer Sachen unbewacht außerhalb unseres Zeltes hatten stehenlassen
müssen, fanden wir doch am nächsten Morgen zu unserer großen Befriedigung
alles an seinem Platz. wir waren einigermaßen in Sorge gewesen, da man uns
auf dem Schiff vor den Diebesgelüsten der Eingeborenen sehr gewarnt hatte.
Aber auch späterhin haben wir uns nur selten über Mangel an Ehrlichkeit bei
den Leuten zu beklagen gehabt."
Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908)
und Arthur Krause (deutscher Naturforscher und Entdeckungsreisender,
1851
bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern,
1881/1882
Aus FREIE WELT 24/1981:
Meine Begegnung mit dem
Sohn des ersten Schriftstellers der Tschuktschen:
Alexander Rytchëu
Wir hatten Juri Rytchëu,
den berühmten tschuktschischen Schriftsteller, auf Tschukotka nicht angetroffen,
weil er mit seiner Familie seit vielen Jahren nicht auf Tschukotka, sondern in
Leningrad (heute Sankt Petersburg) lebte, wo er im Alexander Herzen-Institut der
Völker des Nordens Vorlesungen hielt. Seinen Sohn Alexander aber trafen wir zu
diesem kurzen Interview:

Alexander Rytchëu, der Sohn des
tschuktschischen
Schriftstellers Juri Rytchëu.
Foto: Detlev Steinberg
Alexander Jurjewitsch,
wie kommen Sie - der in Leningrad Geborene - nach Tschukotka?
Vater ließ niemals eine
Gelegenheit aus, meiner Mutter und uns drei Kindern von Tschukotka zu erzählen.
Als ich fünfzehn Jahre alt war, nahm er mich mal mit den in Urlaub, den er fast
immer auf Tschukotka verbringt. Seitdem ließ mich Tschukotka nicht mehr los.
Seit zwei Jahren lebe ich mit meiner Familie hier.
Ihre Mutter ist
Russin... und Ihre Frau?
Meine Frau ist Tatarin. Sie hatte Angst vor all dem Unbekannten und der Kälte.
Inzwischen haben wir viele Freunde gefunden, und die Einwohner ganz Uëlens,
Vaters Geburtsort, halten sich für unsere Verwandten. Wir fühlen uns sehr wohl
auf Tschukotka.
... als Sohn des weltberühmten Schriftstellers...
... ist es einfacher, meinen Sie? Einerseits ja, aber andererseits ist es sogar
schwieriger. Die Erwartungshaltung ist sehr groß, obwohl ich "nur" bei der
Zeitung arbeite. Mein Ziel ist es, ein guter Journalist zu werden.
Haben Sie Kinder?
Einen Sohn, Timur, zwei Jahre alt. Mit
sechzehn Jahren - wenn er seinen Ausweis erhält - wird er selbst entscheiden,
welcher Nationalität er angehören will, der seines Vaters oder der seiner
Mutter. 18 Prozent aller sowjetischen Ehen sind "gemischt" . Ein Beispiel
für nationale Unvoreingenommenheit...
Aus FREIE WELT 10 bis 15/1982:
6 Folgen Rücktitelserie "Auf Eis
Erblühtes", Folge 4 in Heft 13/1982: Zwerg-Birken in der Tundra
"Weiß leuchten
die Stämme der Hänge- und der Moor-Birke in unseren Wäldern. Das helle Grün
ihres sich entfaltenden Laubes ist ein echter Frühlingsbote. Beide Birkensippen
sind stattliche Bäume, die wir auch in den Taigagebieten der Sowjetunion
antreffen. Sie sind es, von denen das russische Volkslied `Berjoska´ (`Birklein´)
singt: `Fröstelnd harre ich aus im hohen Schnee, bis der Frühling kommt...´
Viele weitere
Birkenarten gibt es auf der Nordhalbkugel - sowohl Bäume als auch Sträucher.
Gehen wir etwa vom 58. Grad nördlicher Breite - auf dieser Linie liegen ungefähr
Stockholm, Tallinn, Wologda, Kirow und Tobolsk - weiter nach Norden, so befinden
wir uns im Wohngebiet der Zwerg-Birke (Betula nana LINNÈ). Es reicht von Island
m Westen bis zur Tschuktschen-Halbinsel im Osten. Unter den Zwergsträuchern der
Tundra streckt sie ihre Stämmchen etwa 80 Zentimeter in die Höhe, die kleinen
von ihnen sind nur 30 Zentimeter und weniger hoch. Die Rinde ist nicht wie bei
den genannten baumförmigen Verwandten weiß, sondern braun und mit dicken weißen
Warzen bedeckt. Eine ähnliche Färbung tritt zum Beispiel auch bei der
baumförmigen nordamerikanischen Schwarz-Birke auf. Das Blatt der Zwerg-Birke ist
eigentümlich geformt. Es erscheint in seiner Gesamtgestalt rund, misst man aber
nach, so stellt man fest, dass es breiter als lang ist. Der Rand des kleinen,
etwa pfenniggroßen Blattes ist stumpf gekerbt. Im Herbst nimmt es eine schöne
rötliche Färbung an, behält aber bis zum Abfallen seine Festigkeit. - Die
Fruchtstände (Kätzchen) der Zwerg-Birke sind nur etwa einen halben Zentimeter
lang und stehen aufrecht an den Zweigen. Sie enthalten kleine, rundliche
Nussfrüchte, die einen schmalen Flügelsaum besitzen. Auf der winterlichen
Schneedecke ausgestreut, oftmals vom Wind weit verbreitet, können sie im
Frühjahr nach der Schneeschmelze keimen. (Auch die Früchte unserer baumförmigen
Birke keinen nach einer Kältebehandlung am besten.)
Wirtschaftlich
besitzt die Zwerg-Birke im Gegensatz zu ihren baumförmigen Schwestern keine
Bedeutung. Dafür ist sie wissenschaftlich sehr interessant. Neben dem
ausgedehnten Vorkommen im Norden gibt es Fundorte, im Süden der DDR zum Beispiel
im Erzgebirge und auf dem Brocken, in der BRD und angrenzenden Staaten in den
Alpen, wo wie auf offenen Hochmooren gedeiht. Während der Eiszeit fand sie hier
und anderswo vermutlich Zuflucht vor den nach Süden drängenden Eismassen. Von
hier aus wanderte sie mit Rückgang des Eises wieder nach Norden."
Text von Prof.
Dr. habil Günther Nato, Redakteurin der Serie: Gisela Reller
Lied der Küstentschuktschen:
Wale und Menschen
(Bisher Unveröffentlicht)
Wale und Menschen - ein
einzig Volk! / Als Erde und Meer sich vereinten,/ Die Menschheit geboren
ward, / Zu leben in / Wasser und Wellen / Und zwischen Packeis und
Winterzeit! / Wale und Menschen - ein einzig Volk! / Brüder des Meeres und
der Erde, / zu ewiger Freundschaft geboren! //
Aus dem Russischen von
Raissa Netschajewa, gesammelt von Gisela Reller
"Nicht nur die nordische Natur zieht einen in
ihren Bann. Sehr einnehmend sind auch die Stammbewohner der Tundra, die
Tschuktschen, gutherzige, bescheidene und weise Menschen.
Sputnik Nr.
10/1983
Rezensionen
und
Literaturhinweise
(Auswahl) zu den TSCHUKTSCHEN:
Rezensionen in meiner Webseite
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE REISELITERATUR/BILDBÄNDE:
Klaus Bednarz,
Östlich der Sonne, Vom Baikalsee nach Alaska, Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Reinbeck bei Hamburg 2003.
"Klaus Bednarz hat auf
seiner wochenlangen strapaziösen Reise viel Berichtenswertes erlebt, aber er
hat auch vor und nach seiner Reise intensiv recherchiert. Trotzdem
überschüttet er den Leser nicht mit Informationen, sondern lässt diese meist
durch seine Gesprächspartner mitteilen, die dem sympathischen,
wissbegierigen deutschen Journalisten meist sehr offen antworten. Bednarz
schildert wahrheitsgetreu, was er sieht und hört, und man spürt sein warmes
Gefühl, das er den sibirischen Menschen entgegenbringt."
In:
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE BELLETRISTIK:
Tatjana Kuschtewskaja, Mein geheimes Russland,
Reportagen, Mit 70 Fotos, Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt, Claudia
Catz, Verena Flick und Alexander Nitzberg, Grupello Verlag, Düsseldorf 2000.
"Es gibt zweierlei
Russland, schreibt die Kuschtewskaja. `Das eine sehen die Deutschen auf dem
Bildschirm oder in Büchern deutscher Fernsehjournalisten. Das andere
Russland erzählt selbst von sich. Es schreibt über sich und sieht sich von
innen, und das ist sachkundiger und tiefer.´"
In:
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE
REISELITERATUR/BILDBÄNDE:
Thomas
Roth,
Russisches Tagebuch, Eine Reise von den Tschuktschen bis zum Roten Platz, List
Verlag, München 2002.
"Roth hatte, bevor er
dieses Buch schrieb, als ARD-Korrespondent drei Wochen lang Tag für Tag live
aus vielen Orten des größten Staates der Welt berichtet. Den Buch-Leser
lässt Roth nacherleben, was es organisatorisch und nervlich bedeutet, mit
`berüchtigten´ eineinhalb Tonnen Fernseh-Dreh-Gepäck durch das teils
chaotische Land zu reisen und auf die Minute genau die Beiträge nach
Deutschland übertragen zu müssen. Die 26 000 Kilometer lange Reise führte
Roth und sein Team vom östlichsten Punkt Russlands am Eismeer in Lawrentija
über die vulkanische Halbinsel Kamtschatka nach Sibirien und in den Fernen
Osten und von dort über St. Petersburg und Königsberg zurück nach Moskau."
In:
www.reller-rezensionen.de
KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri Rytchëu,
Unna, Aus dem Russischen von Charlotte und Leonhard Kossuth, Unionsverlag,
Zürich 1997.
"Unna, die ihren Vater
auch wegen seines ständigen Wermutgestanks angeekelt verleugnete, ihn ins
Altersheim abschob, ohne sich um ihn zu kümmern, ja, ohne auch nur an ihn zu
denken, beginnt aus Verzweiflung selbst zu trinken. Oft tagelang
hintereinander. Zuletzt verdient sie ihr Brot als Pförtnerin. - Eine
Tschuktschenfrau, die das Mitleid des Lesers verdient? Vielleicht. Meines
hat sie nicht. Für mich ist sie von Rytchëu zu scheuklappengläubig und
gemein angelegt. Überhaupt spielen in dem Buch nur machtgierige Funktionäre
eine Rolle und stockbesoffene Einheimische, `die sich bis zur
Bewusstlosigkeit betranken, sich dann in Gräben, Hinterhöfen und Müllgruben
wälzten´. Nicht ohne Grund, das wird aus dem Buch klar, sondern weil viele
Rentierzüchter arbeitslos sind, ehemalige Meerestierjäger selbst keine Jagd
mehr auf Wale machen dürfen, traditionelle Fischer, weil zwangsumgesiedelt,
nicht mehr fischen können, weil sich das Meer nicht mit umsiedeln ließ. Ich
weiß, dass es zu ungezählten Selbstmorden kam, zu fürchterlichem
Alkoholismus. Aber ich sah bei meinem Aufenthalt auf dem exotisch-schönen
Tschukotka durchaus auch normale Einheimische, die sowohl ihrer
traditionellen Arbeit als Rentierzüchter nachgingen als auch moderner
Tätigkeit als Goldwäscher oder sogar als geschätzte Mitarbeiter des
Atomkraftwerks von Bilibino."
In:
www.reller-rezensionen.de
*
KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri Rytchëu,
Im Spiegel des Vergessens, Aus dem Russischen von Charlotte und Leonhard Kossuth,
Unionsverlag, Zürich 1999.
"Der informierte Leser
wird bald merken, dass es sich bei diesem Buch um eine (kaum) chiffrierte
Autobiographie handelt. Die im Buch genannten Personen sind zumeist real -
ob Wissenschaftler oder Schriftsteller, Vorfahren und Verwandte Gemos (in
Wahrheit Vorfahren und Verwandte des Autors) wie Mletkyn,
Rytchëus
Großvater, der ein Großer Schamane war und von den Bolschewiki erschossen
wurde."
In:
www.reller-rezensionen.de
*
KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri
Rytchëu, Die Reise der Anna Odinzowa,
Aus dem Russischen von Charlotte und
Leonhard Kossuth, Unionsverlag, Zürich 2000.
"Anna Odinzowa
jedenfalls lernt in der Tundra alle Bräuche von der Geburt bis zum Tode
kennen, kann bald schon jedes Kleidungsstück zuschneiden und nähen, kann
Felle bearbeiten, Fäden aus Rensehnen drehen, eine Jaranga errichten,
Rentiere anspannen, ein geschlachtetes Ren ausweiden und Brei aus dem Inhalt
der ersten Kammer eines Renmagens zubereiten. Nach einem Jahr unterscheiden
sie von den tschuktschischen Tundrafrauen nur noch ihre blauen Augen und die
blonden Haare."
In:
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri
Rytchëu, Der letzte Schamane, Die Tschuktschen-Saga, Aus dem
Russischen von Antje Leetz, Unionsverlag, Zürich 2002.
"Rytchëu (sprich:
Ryt-che-u) beginnt seine Tschuktschen-Saga mit einer Vorbemerkung: `Wo ich
geboren wurde, da wachsen kein Wald und keine hohen Bäume. Aber das heißt
nicht, dass es dort überhaupt keine Pflanzen gibt. Es gibt sogar Birken,
Zedern, Weiden, Erlen. Allerdings ragt die Krone des größten dieser `Bäume´
nur wenige Zentimeter aus dem Erdboden.´ Juri Rytchëu ist 1930 als Sohn
eines Fischers jenseits der Baumgrenze geboren worden, in Uëlen (sprich:
U-e-len), dem allerletzten besiedelten nordöstlichen Landzipfel der
Russischen Föderation. `Meine Ahnentafel´, schreibt Rytchëu, `gleicht dem
Tundragewächs Junëu - der Goldenen Wurzel, die fest in der Muttererde
verankert ist. Sie sitzt nicht tief, denn der ewige Frost macht den Boden
hart. Aber kein Sturm kann sie ausreißen, keine Kälte ihre Wurzeln abtöten.
Genau so stelle ich mir meine Wurzeln vor, die ich in diesem Buch bis zu den
frühesten Ursprüngen zu ergründen suche."
In:
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri
Rytchëu, Der Mondhund,
Aus dem Russischen von Antje Leetz, Unionsverlag, Zürich 2005.
"Juri Rytchëus zehntes
deutsch erschienenes Buch `Der Mondhund´ ist ein tschuktschisches Märchen
für Erwachsene über die Große Liebe und über viele Fragen des Lebens. Der
Mondhund ist ein dunkelfelliger junger Polarhund, ein kräftiger Rüde.
Warum rennt auf dem Schutzumschlag statt eines dunklen Hundes ein weißer
Wolf durch den Schnee? Auffällig ist an dem Mondhund ein besonderes Leuchten
der Augen, der ungewöhnliche Klang seiner Stimme und sein Wille, bis an den
Rand des einzigen Nachtlichts am Himmel zu fliegen und hinein zu beißen. Der
Leithund seiner Sippe heißt Vierauge, weil er auf der Stirn über seinen
blauen Augen zwei weiße Flecke hat, `die den Schnitt der Augen haargenau
wiederholten´; er ist des Mondhundes Vater. Sein junger Sohn ist der Schwarm
aller Hündinnen. Doch der sagt seinem Vater unmissverständlich, dass er
nicht heiraten wird; denn `er wusste, wenn er Vater werden würde, müsste er
für immer im Rudel bleiben, sich um den Nachwuchs kümmern, Nahrung suchen,
die Kinder vor Überfällen der Feinde beschützen - vor dem Wolf, dem
Vielfraß, dem Fuchs, dem Polarfuchs und dem Braunbär. Sogar vor dem Raben,
der neugeborene Welpen mit dem Schnabel tot hacken konnte. Er ahnte, dass
der Augenblick des Genusses schnell von Gleichgültigkeit abgelöst wird, dass
die Flamme der Leidenschaft verlöscht und nur einen Aschehaufen von
Erinnerungen zurücklässt´."
In:
www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE BELLETRISTIK:
Juri
Rytchëu,
Polarfeuer, Aus dem Russischen von Antje Leetz,
Unionsverlag, Zürich 2007.
"`Polarfeuer´ ist die
Fortsetzung von `Traum im Polarnebel´. Spielt der erste Band in den Jahren
1912 bis 1920, vor Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
(UdSSR), so ist die Handlung von Band 2 in den zwanziger bis dreißiger
Jahren angesiedelt, spielt also bereits in der Sowjetära - die da auch im
fernen Tschukotka angekommen ist."
In:
www.reller-rezensionen.de
*
HÖRBUCH:
Juri
Rytchëu, Der Mondhund,
Aus dem Russischen von Antje Leetz,
Lesung, Sprecher: Karl Menrad, Goya LiT, Zürich 20052 CDs.
"In dem den CD´s
beigelegten bescheidenen Textheftchen sind tschuktschische Begriffe erklärt
und ist die Widmung des Autors abgedruckt: `Beendet am 26. Juli 2003, am
vierzehnten Tag nach dem Tod meiner Tirkyneu mit Namen Galja. Dieses Buch,
das in der schwersten Zeit ihrer Leiden entstand, ist ihr gewidmet. Viele
Seiten konnte sie noch selbst hören.´ Ich kannte Rytchëus Frau Galja, die er
meine Tirkyneu nennt, und weiß von ihr, dass sie zu den Überlebenden der
Leningrader Blockade gehörte. Zwei Einsame, eine Russin und ein Tschuktsche,
hatten sich für immer zusammengefunden."
In:
www.reller-rezensionen.de
HÖRBUCH: Juri
Rytchëu,
Traum im Polarnebel, Aus dem Russischen von Arno
Specht, Lesung, Sprecher: Manfred Zapatka, Der Hörverlag, München 2003, 4 CDs,
Mit Booklet.
"`Traum im
Polarnebel´ spielt in den Jahren 1912 bis 1920, vor der Gründung der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). In einem Küstendorf
Tschukotkas im äußersten Nordosten Russlands, in Enmyn, strandet das
Walfangschiff `Belinda´. An Bord ist auch der Kanadier John MacLennan. Durch
ein tragisches Missgeschick wird er schwer an den Händen verwundet. Drei
Ureinwohner sollen John (den die Tschuktschen Son nennen), in die russische
Stadt Anadyr (heute Tschukotkas Hauptstadt) bringen, weil dort ein
russischer Arzt ansässig ist. Doch unterwegs setzt bei John Wundbrand ein.
Die drei Ureinwohner Toko (sprich: Tokó), Orwo (sprich: Orwó) und Armol
rufen die Schamanin Kelena zu Hilfe. John MacLennan glaubt, sein letztes
Stündchen habe geschlagen..."
In:
www.reller-rezensionen.de
Literaturhinweise (Auswahl)
* Hans
Bauer, Knud Rasmussen,
Ein Leben für die Eskimo, VEB F. A. Brockhaus Verlag, Leipzig 1974.
Der Autor zeichnet ein fesselndes Bild von der ungewöhnlichen
Forscherpersönlichkeit Knud Rasmussens. Und er schildert Episoden aus den fünf
Expeditionen Rasmussens, die den Eskimoalltag darstellen u. a. gefährliche
Jagden und Geisterbeschwörungen.
"Später stellte sich
heraus, daß Amundsens Schiff in einer kleinen Bucht der
Tschuktschen-Halbinsel eingefroren war und Amundsen überwintern mußte. Kaum
hatte er das Schiff freibekommen, fror es noch einmal ein. Erst im Mai 1920
gelangte ein Telegramm aus der Sowjetunion nach Europa - Amundsens erstes
Lebenszeichen."

Roald Amundsen in Polarausrüstung.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
* Lieselotte Düngel-Gilles, Knud Rasmussen,
Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin 1970.
Die Autorin zeichnet in ihrem Buch ein echtes, unromantisches Bild der
Eskimos, wie Rasmusen es in seinen Tagebüchern überliefert hat. Zugleich
führt sie uns die Gestalt des großen Forschers vor Augen, den die Eskimo
Bruder nannten.
"Jetzt hatte er [Knud
Rasmussen] sein Ziel erreicht, er war bei dem westlichsten aller
Eskimostämme angelangt, bei den Tschuktschen, die am Ostkap Sibiriens leben.
Am Abhang des Berges, auf dem er stand, sah er eine Schar Tschuktschenfrauen
in Tierfellkleidern. Auf dem Rücken trugen sie Beutel aus Rentierhaut, um
Kräuter und Beeren zu sammeln. Auf der schmalen Landzunge zu seinen Füßen,
zwischen Packeis und offenem Meer, lag ein Dorf. Aus den Zelten aus
Walroßhaut stieg Rauch. Unweit des Dorfes zog eine Herde Rentiere mit ihren
Hirten vorbei. Ein friedliches, ein alltägliches Bild, aber für Knud
Rasmussen war es das Ziel, war es die Erfüllung."
*Aurel und Arthur Krause, Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den
Tlinkit-Indianern 1881/82, Reisetagebücher und Briefe, Dietrich Reimer Verlag,
Berlin 1984.

Viel Idealismus und
Hilfsbereitschaft sind mit der Reise nach Tschukotka verbunden. Denn die Brüder
Krause (rechts Arthur, links Aurel) erfüllten ihre Forschungsaufträge einzig im Dienst
der Wissenschaft, ohne
persönliches Entgelt.
Fotos aus: Rellers
Völkerschafts-Archiv
1881 wurden die deutschen Brüder Aurel und Arthur Krause von der Geographischen
Gesellschaft in Bremen mit der Durchführung einer natur- und
völkerkundlichen Expedition zur Beringstraße beauftragt. Sie traten die Reise am
15. April 1881 an und erreichten über Bremerhaven, New York und San Francisco am
6. August die Sankt-Lorenz-Bucht. In den folgenden acht Wochen erforschten sie
die Küsten und küstennahen Gebiete der Tschuktschen-Halbinsel zwischen Uëlen am
Kap Deshnjew und der Prowidenija Bucht im Süden. Das Ergebnis war eine Fülle
natur- und völkerkundlicher Beobachtungen, belegt durch zahlreiche
Sammlungsstücke.
* Juri Rytchëu, Menschen an unserem Gestade, Erzählungen,
Verlag Volk und Welt, Berlin 1954.
* Juri Rytchëu, Abschied von den Göttern.
Das ist die Geschichte des liebenswerten und aufgeweckten
Tschuktschenjungen Ryntin, mit dem wir den ersten Schultag erleben, das
Ferienlager, in dem es so ungewohnte Dinge wie Betten und Badehäuser gibt, mit
dem wir auf Entenjagd gehen und erleben, wie ihn die Schamanin Peep mit ihren
Zauberformeln von einer schweren Krankheit heilen will...
* Juri Rytchëu, Weket und Agnes,
Der Kinderbuchverlag, Berlin 1974.
* Juri Rytchëu, Als die Wale fortzogen, Aufbau-Verlag,
Berlin und Weimar 1979.
* Juri Rytchëu,
Alphabet meines Lebens, Unionsverlag, Zürich 2008.
* Schundik, Der weiße Schamane, Verlag Neues
Leben, Berlin 1980.
*
Juri Simtschenko, Am Rande der Arktis - Bei
Tschuktschen, Nenzen und Dolganen.
* Tichon Sjomuschkin, Im Land
der Tschuktschen.
* Tichon Sjomuschkin, Brand in der
Polarnacht.
* Nikolai Schundik, Schnelles Rentier, Deutsch von Willi Berger, Verlag
Kultur und Fortschritt, Berlin 1955.
* Sawwa Uspenski, Tiere in Eis und Schnee, F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig
1983.
In diesem Buch berichtet der in Fachkreisen im In- und Ausland gut bekannte
Polarforscher über seine Expeditionen im Hohen Norden, über die so sehr
verwundbare Natur der Arktis und die charakteristischen Vertreter ihrer
Tierwelt: über die zauberhaft schöne Rosenmöwe, den auf der Wrangelinsel wieder
"eingebürgerten" Moschusochsen, den Wal, das Ren, die Kaisergans und den scheuen
Schneekranich. Auch von seinem Lieblingstier, dem Eisbären, hat er wieder Neues
mitzuteilen. Gleichzeitig soll dieses Buch nach dem Willen des Autors eine Art `Notruf´an
die Menschen sein: All diese gefährdeten Tiere benötigen unseren Schutz, nicht
nur weil sie dem Menschen in irgendeiner Form nützlich sind - die Natur der
Arktis muß insgesamt in ihrer Eigenständigkeit erhalten bleiben. dem Menschen
von heute sowie künftigen Generationen zur Freude.
* Als die Wale fortzogen, Herausgegeben von Margit Bräuer, die auch das Nachwort
schrieb, Fünf Novellen, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1979.
Über die titelgebende Novelle von Juri Rytchëu
schreibt Margit Bräuer in ihrem Nachwort: "In Form einer `modernen Legende´, die
in ihrer poetischen Bildsprache ganz aus der bis heute lebendigen Folklore
[der Tschuktschen] schöpft, behandelt der
Autor mit Hilfe eines märchenhaft anmutenden Sujets das Verhältnis zwischen
Mensch und natur, das, wie Rytchëu
nachweisen will, für beide Teile ersprießlich ist, solange zwischen innen das
Band der Liebe und das Gesetz der Brüderlichkeit unverletzt sind, das aber
tödliche Folgen für beide Teile haben kann, wenn der Mensch in seinem übermäßig
gewordenen Genuss- und Herrschaftsdrang Brudermord begeht, wenn er die Natur
ausplündert und dadurch tötet. Aktuelle Probleme der Ökologie gehen hier mit
urgeschichtlicher Mythologie eine orignelle Symbiose ein. Die in das Symbol von
Mensch-Wal-Brüdern gekleidete Allegorie wird natürlich und ungekünstelt, weil
ihr eine ungebrochene Beziehung zu der ihm umgebenden Natur zugrunde liegt.
* Die Sonnentochter und andere Märchen der Tundra, darin die tschuktschischen
Märchen"Tyrkyneku und die schöne Gytinnäu", "Der schreckliche Hase", "Das
Märchen von der Kranichfrau", "Denken ist schwer!" und "Der Prahlhans", Die von
Margarete Spady übersetzten Märchen wurden von Lieselotte Fleck nacherzählt,
Zeichnungen: N. G. Basmanowa, Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1954.

Von 1953 bis 1956 habe ich im Berliner Verlag
Kultur und Fortschritt Verlagsbuchhändlerin gelernt. Als 1954 "Die
Sonnentochter und andere Märchen der Tundra" erschien, erfuhr ich das erste
Mal von Völkern wie Eskimos, Ewenen, Ewenken,
Itelmenen [Kamtschadalen], Jakuten, Jukagiren, Keten, Korjaken,
Mansen, Nanaier, Nenzen, Nganassanen, Niwchen, Oroken, Saamen
[Lappen], Selkupen, Tschuktschen,
Udehen. Ich war fasziniert!
Es sollte dann noch
fast ein Vierteljahrhundert vergehen, bis ich die Lebensorte dieser Völker
als Journalistin der Illustrierten FREIE WELT selbst bereiste.
Gisela Reller
* Märchen der Nordvölker, Die Herrin des Feuers, Verlag Progress, Moskau
1974 (in deutscher Sprache).
Darin auch Märchen der Tschuktschen.

Zeichnung von Vitali Petrow-Kamtschatski aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
* Die goldene Schale und andere Märchen der
Völker der Sowjetunion, darin: das tschuktschische Märchen "Das Mädchen und der
Mond", aus dem Russischen von H. Eschwege und L. Labas, Verlag Progess,
Moskau 1975 (?).
* Märchen der Völker des Nordens, Der Rabe Kutcha, Verlag Malysch, Moskau
1976 (in deutscher Sprache).
Von den fernen Küsten der eisigen Meere des Nordens, aus den Weiten der
Tundra, aus der Taigawildnis und von den Ufern der riesigen sibirischen
Ströme kommen diese tschuktschischen Märchen, deren Helden Tiere sind.
* Märchen aus dem hohen Norden der Sowjetunion, Die Kranichfeder, Für Kinder
nacherzählt von N. Gesse und S. Sadunaiskaja, Mit Illustrationen von Manfred
Butzmann, 4. Auflage, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1983.
Jäger und Rentierzüchter sind die Helden dieser Märchen. Sie fahren mit dem
Schneesturm um die Wette, ringen mit eisernen Ungeheuern, messen ihre Kräfte mit
Waldriesen und verehren die Herrin des Feuers. Vielfältig spiegelt sich das
Leben der Völker aus dem hohen Norden in seiner reichen Folklore, auch das der
Tschuktschen.
"Man konnte in der tschuktschischen Sprache
jemanden nennen, wie man wollte, ihn mit jedem abscheulichen und
blutgierigen Tier vergleichen, sogar mit Scheiße, aber die schrecklichste
Beleidigung war, ihn als `schlechten Menschen´ zu bezeichnen."
Juri Rytchëu
(1930 bis 2008) in: Polarfeuer, 2009

Bibliographie
zu
Gisela Reller
Bücher als Autorin:
Länderbücher:
* Zwischen Weißem Meer und Baikalsee,
Bei den Burjaten, Adygen und Kareliern, Verlag Neues Leben, Berlin 1981,
mit Fotos von Heinz Krüger und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
* Diesseits und jenseits des
Polarkreises,
bei den Südosseten, Karakalpaken, Tschuktschen und asiatischen Eskimos, Verlag
Neues Leben, Berlin 1985, mit Fotos von Heinz Krüger und Detlev
Steinberg und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
* Von der Wolga bis zum Pazifik,
bei Tuwinern, Kalmyken, Niwchen und Oroken, Verlag der Nation, Berlin 1990, 236
Seiten mit Fotos von Detlev Steinberg und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
Biographie:
* Pater Maksimylian Kolbe,
Guardian von Niepokalanów und Auschwitzhäftling Nr. 16 670,
Union Verlag, Berlin 1984, 2. Auflage.
... als
Herausgeberin:
Sprichwörterbücher:
*
Aus Tränen baut man keinen Turm,
ein kaukasischer Spruchbeutel,
Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten, Eulenspiegel
Verlag Berlin in zwei Auflagen (1983 und 1985), von mir übersetzt und
herausgegeben, illustriert von Wolfgang Würfel.
*
Dein Freund ist dein Spiegel,
ein Sprichwörter-Büchlein mit 111
Sprichwörtern der Adygen, Dagestaner Kalmyken,
Karakalpaken, Karelier, Osseten, Tschuktschen und
Tuwiner, von mir gesammelt und zusammengestellt, mit einer Vorbemerkung und
ethnographischen Zwischentexten versehen, die Illustrationen stammen von Karl
Fischer, die Gestaltung von Horst Wustrau, Herausgeber ist die Redaktion FREIE WELT, Berlin
1986.
*
Liebe auf Russisch,
ein in Leder gebundenes Mini-Bändchen im Schuber
mit Sprichwörtern zum Thema „Liebe“, Buchverlag Der Morgen, Berlin 1990, von mir
(nach einer Interlinearübersetzung von Gertraud Ettrich) in Sprichwortform
gebracht, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, illustriert von Annette
Fritzsch.
Aphorismenbuch:
* 666 und sex mal
Liebe, Auserlesenes, 2. Auflage, Mitteldeutscher Verlag
Halle/Leipzig, 200 Seiten mit Vignetten und Illustrationen von Egbert Herfurth.
... als
Mitautorin:
Kinderbücher:
*
Warum? Weshalb? Wieso?, Ein
Frage-und-Antwort-Buch für Kinder, Band 1 bis 5, Herausgegeben von Carola Hendel,
reich illustriert, Verlag Junge Welt, Berlin 1981 -1989.
Sachbuch:
* Die
Stunde Null,
Tatsachenberichte über tapfere Menschen in den letzten Tagen
des zweiten Weltkrieges, Hrsg. Ursula Höntsch, Verlag der Nation 1966.
* Kuratorium zur kulturellen
Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e. V., Herausgegeben von Leonhard Kossuth unter Mitarbeit von Gotthard Neumann, Nora
Verlag 2008.
... als
Verantwortliche Redakteurin:
* Leben
mit der Erinnerung, Jüdische Geschichte in Prenzlauer Berg, Edition
Hentrich, Berlin 1997, mit zahlreichen Illustrationen.
* HANDSCHLAG,
Vierteljahreszeitung für deutsche Minderheiten im Ausland, Herausgegeben vom
Kuratorium zur kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e.
V., Berlin 1991 - 1993.

Die erste Ausgabe von HANDSCHLAG liegt vor. Von
links: Dr. Gotthard Neumann, Leonhard Kossuth (Präsident), Horst Wustrau (Gestalter von HANDSCHLAG), Gisela Reller, Dr. Erika Voigt (Mitarbeiter des Kuratoriums zur
kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e. V.).
Foto
aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
"Der bittere Kampf um die Befriedigung der
dringenden leiblichen Bedürfnisse hindert alle Entwickelung des
Seelenlebens. Nur der Handelsverkehr mit zivilisierten Nationen weckt
einigermaßen den Verstand. Die Tschuktschen gehören zu den geistig
gewecktesten Horden..."
A. W. Grube Hrsg.), Geographische
Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu
einer bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig
1891
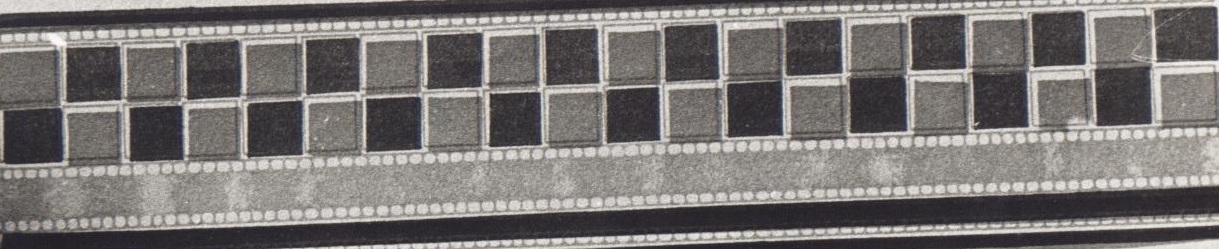
Pressezitate
(Auswahl)
zu Gisela Rellers
Buchveröffentlichungen:
Dieter Wende in der „Wochenpost“
Nr. 15/1985:
„Es ist schon eigenartig, wenn
man in der Wüste Kysyl-Kum von einem Kamelzüchter gefragt wird: `Kennen Sie
Gisela Reller?´ Es ist schwer, dieser Autorin in entlegenen sowjetischen
Regionen zuvorzukommen. Diesmal nun legt sie mit ihrem Buch
Von der Wolga bis
zum Pazifik Berichte aus Kalmykien, Tuwa und von der Insel Sachalin vor.
Liebevolle und sehr detailgetreue Berichte auch vom Schicksal kleiner Völker.
Die ethnografisch erfahrene Journalistin serviert Besonderes. Ihre Erzählungen
vermitteln auch Hintergründe über die Verfehlungen bei der Lösung des
Nationalitätenproblems.“
B(erliner) Z(eitung) am Abend vom 24. September
1981:
"Gisela Reller, Mitarbeiterin der Illustrierten FREIE WELT,
hat autonome Republiken und Gebiete kleiner sowjetischer Nationalitäten bereist:
die der Burjaten, Adygen und Karelier. Was sie dort ... erlebte und was Heinz
Krüger fotografierte, ergíbt den informativen, soeben erschienenen Band
Zwischen Weißem Meer und Baikalsee."
Sowjetliteratur (Moskau)Nr. 9/1982:
"(...)
Das ist eine lebendige, lockere Erzählung über das Gesehene und Erlebte,
verflochten mit dem reichhaltigen, aber sehr geschickt und unaufdringlich
dargebotenen Tatsachenmaterial. (...) Allerdings verstehe ich sehr gut, wie viel
Gisela Reller vor jeder ihrer Reisen nachgelesen hat und wie viel Zeit nach der
Rückkehr die Bearbeitung des gesammelten Materials erforderte. Zugleich ist es
ihr aber gelungen, die Frische des ersten `Blickes´ zu bewahren und dem Leser
packend das Gesehene und Erlebte mitzuteilen. (...) Es ist ziemlich lehrreich -
ich verwende bewusst dieses Wort: Vieles, was wir im eigenen Lande als
selbstverständlich aufnehmen, woran wir uns ja gewöhnt haben und was sich
unserer Aufmerksamkeit oft entzieht, eröffnet sich für einen Ausländer, sei es
auch als Reisender, der wiederholt in unserem Lande weilt, sozusagen in neuen
Aspekten, in neuen Farben und besitzt einen besonderen Wert. (...) Mir gefällt
ganz besonders, wie gekonnt sich die Autorin an literarischen Quellen, an die
Folklore wendet, wie sie in den Text ihres Buches Gedichte russischer Klassiker
und auch wenig bekannter nationaler Autoren, Zitate aus literarischen Werken,
Märchen, Anekdoten, selbst Witze einfügt. Ein treffender während der Reise
gehörter Witz oder Trinkspruch verleihen dem Text eine besondere Würze. (...)
Doch das Wichtigste im Buch Zwischen Weißem Meer und Baikalsee
sind die Menschen, mit denen Gisela Reller auf ihren
Reisen zusammenkam. Unterschiedlich im Alter und Beruf, verschieden ihrem
Charakter und Bildungsgrad nach sind diese Menschen, aber über sie alle vermag
die Autorin kurz und treffend mit Interesse und Sympathie zu berichten. (...)"
Neue Zeit vom 18. April 1983:
„In ihrer biographischen Skizze
über den polnischen
Pater Maksymilian Kolbe
schreibt Gisela Reller (2.
Auflage 1983) mit Sachkenntnis und Engagement über das Leben und Sterben dieses
außergewöhnlichen Paters, der für den Familienvater Franciszek Gajowniczek
freiwillig in den Hungerbunker von Auschwitz ging.“
Der
Morgen vom 7. Februar 1984:
„`Reize lieber einen Bären als
einen Mann aus den Bergen´. Durch die Sprüche des
Kaukasischen Spruchbeutels
weht der raue Wind des Kaukasus. Der Spruchbeutel erzählt auch von
Mentalitäten, Eigensinnigkeiten und Bräuchen der Adygen, Osseten und Dagestaner.
Die Achtung vor den Alten, die schwere Stellung der Frau, das lebensnotwendige
Verhältnis zu den Tieren. Gisela Reller hat klug ausgewählt.“

1985 auf dem Solidaritätsbasar auf dem Berliner
Alexanderplatz: Gisela Reller (vorne links) verkauft ihren „Kaukasischen Spruchbeutel“ und 1986 das
extra für den Solidaritätsbasar von ihr herausgegebene Sprichwörterbuch „Dein Freund ist
Dein Spiegel“.
Foto: Alfred Paszkowiak
Neues Deutschland vom 15./16.
März 1986:
"Vor allem der an Geschichte,
Bräuchen, Nationalliteratur und Volkskunst interessierte Leser wird manches
bisher `Ungehörte´ finden. Er erfährt, warum im Kaukasus noch heute viele Frauen
ein Leben lang Schwarz tragen und was es mit dem `Ossetenbräu´ auf sich hat,
weshalb noch 1978 in Nukus ein Eisenbahnzug Aufsehen erregte und dass vor
Jahrhunderten um den Aralsee fruchtbares Kulturland war, dass die Tschuktschen
vier Begriff für `Freundschaft´, aber kein Wort für Krieg besitzen und was ein
Parteisekretär in Anadyr als notwendigen Komfort, was als entbehrlichen Luxus
ansieht. Großes Lob verdient der Verlag für die großzügige Ausstattung von
Diesseits und jenseits des Polarkreises.“

Gisela Reller während einer ihrer über achthundert
Buchlesungen
in der Zeit von 1981 bis 1991.
Berliner Zeitung vom 2./3. Januar 1988:
„Gisela Reller hat
klassisch-deutsche und DDR-Literatur auf Liebeserfahrungen durchforscht und ist
in ihrem Buch
666 und sex mal Liebe 666 und sex mal fündig geworden.
Sexisch illustriert, hat der Mitteldeutsche Verlag Halle alles zu einem hübschen
Bändchen zusammengefügt.“
Neue Berliner Illustrierte (NBI) Nr. 7/88:
„Zu dem wohl jeden bewegenden
Thema finden sich auf 198 Seiten
666 und sex mal Liebe
mannigfache Gedanken von Literaten, die heute
unter uns leben, sowie von Persönlichkeiten, die sich vor mehreren Jahrhunderten
dazu äußerten.“
Das
Magazin Nr. 5/88.
"`Man
gewöhnt sich daran, die Frauen in solche zu unterscheiden, die schon bewusstlos
sind, und solche, die erst dazu gemacht werden müssen. Jene stehen höher und
gebieten dem Gedenken. Diese sind interessanter und dienen der Lust. Dort ist
die Liebe Andacht und Opfer, hier Sieg und Beute.´ Den Aphorismus von Karl Kraus
entnahmen wir dem Band 666 und sex mal Liebe,
herausgegeben von Gisela Reller und illustriert von Egbert Herfurth."
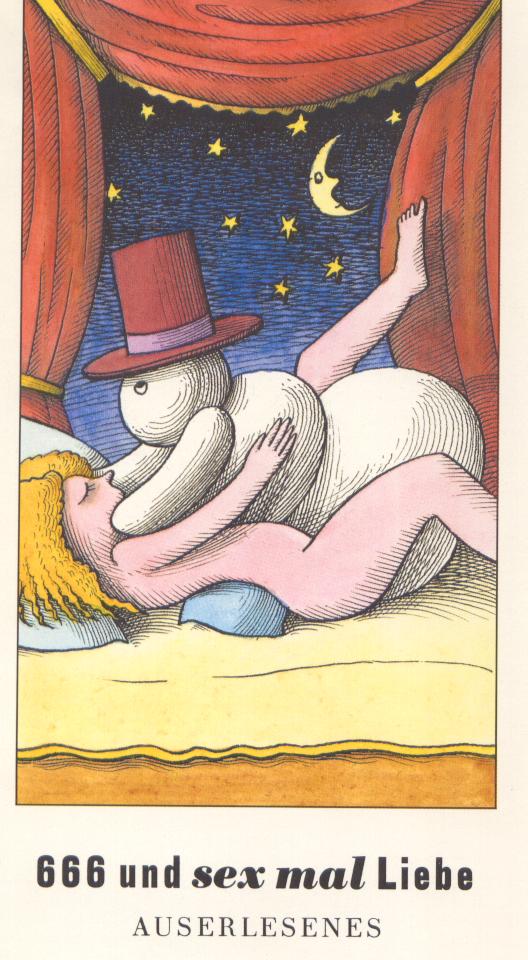
Schutzumschlag zum „Buch 666 und sex mal Liebe“ .
Zeichnung: Egbert Herfurth
FÜR DICH, Nr. 34/89:
"Dem beliebten Büchlein 666 und sex
mal Liebe entnahmen wir die philosophischen und frechen Sprüche für
unser Poster, das Sie auf dem Berliner Solidaritätsbasar kaufen können. Gisela
Reller hat die literarischen Äußerungen zum Thema Liebe gesammelt, Egbert
Herfurth hat sie trefflich illustriert."
Messe-Börsenblatt, Frühjahr 1989:
"Die Autorin – langjährige
erfolgreiche Reporterin der FREIEN WELT - ist bekannt geworden durch ihre Bücher
Zwischen Weißem Meer und Baikalsee und Diesseits und jenseits des
Polarkreises. Diesmal schreibt die intime Kennerin der Sowjetunion in ihrem Buch
Von der Wolga
bis zum Pazifik
über die Kalmyken, Tuwiner und die Bewohner von Sachalin,
also wieder über Nationalitäten und Völkerschaften. Ihre Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft wird uns in fesselnden Erlebnisberichten nahegebracht."
Im Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel schrieb
ich in der Ausgabe 49 vom 7. Dezember 1982 unter der Überschrift „Was für ein
Gefühl, wenn Zuhörer Schlange stehen“:
„Zu den diesjährigen Tagen des
sowjetischen Buches habe ich mit dem Buch
Zwischen Weißem Meer und Baikalsee
mehr als zwanzig Lesungen bestritten. (…) Ich las vor einem Kreis von vier
Personen (in Klosterfelde) und vor 75 Mitgliedern einer DSF-Gruppe in Finow;
meine jüngsten Zuhörer waren Blumberger Schüler einer 4. Klasse, meine älteste
Zuhörerin (im Schwedter Alten- und Pflegeheim) fast 80 Jahre alt. Ich las z.B.
im Walzwerk Finow, im Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, im Petrolchemischen
Kombinat Schwedt; vor KIM-Eiersortierern in Mehrow, vor LPG-Bauern in Hermersdorf, Obersdorf und Bollersdorf; vor zukünftigen Offizieren in
Zschopau; vor Forstlehrlingen in Waldfrieden; vor Lehrlingen für
Getreidewirtschaft in Kamenz, vor Schülern einer 7., 8. und 10 Klasse in Bernau,
Schönow und Berlin; vor Pädagogen in Berlin, Wandlitz, Eberswalde. - Ich weiß
nicht, was mir mehr Spaß gemacht hat, für eine 10. Klasse eine Geographiestunde
über die Sowjetunion einmal ganz anders zu gestalten oder Lehrern zu beweisen,
dass nicht einmal sie alles über die Sowjetunion wissen – was bei meiner
Thematik – `Die kleinen sowjetischen Völkerschaften!´ – gar nicht schwer zu
machen ist. Wer schon kennt sich aus mit Awaren und Adsharen,
Ewenken und Ewenen, Oroken und Orotschen, mit
Alëuten, Tabassaranern, Korjaken, Itelmenen, Kareliern…
Vielleicht habe ich es leichter, Zugang zu finden als mancher Autor, der `nur´
sein Buch oder Manuskript im Reisegepäck hat. Ich nämlich schleppe zum
`Anfüttern´ stets ein vollgepacktes Köfferchen mit, darin von der Tschuktschenhalbinsel ein echter Walrosselfenbein-Stoßzahn, Karelische Birke,
burjatischer Halbedelstein, jakutische Rentierfellbilder, eskimoische
Kettenanhänger aus Robbenfell, einen adygeischen Dolch, eine karakalpakische
Tjubetejka, der Zahn eines Grauwals, den wir als FREIE WELT-Reporter mit
harpuniert haben… - Schön, wenn alles das ganz aufmerksam betrachtet und
behutsam befühlt wird und dadurch aufschließt für die nächste Leseprobe. Schön
auch, wenn man schichtmüde Männer nach der Veranstaltung sagen hört: `Mensch,
die Sowjetunion ist ja interessanter, als ich gedacht habe.´ Oder: `Die haben ja
in den fünfundsechzig Jahren mit den `wilden´ Tschuktschen ein richtiges Wunder
vollbracht.´ Besonders schön, wenn es gelingt, das `Sowjetische Wunder´ auch
denjenigen nahezubringen, die zunächst nur aus Kollektivgeist mit ihrer Brigade
mitgegangen sind. Und: Was für ein Gefühl, nach der Lesung Menschen Schlange
stehen zu sehen, um sich für das einzige Bibliotheksbuch vormerken zu
lassen. (Schade, wenn man Kauflustigen sagen muss, dass das Buch bereits
vergriffen ist.) – Dank sei allen gesagt, die sich um das zustande kommen von Buchlesungen mühen – den Gewerkschaftsbibliothekaren der Betriebe, den Stadt-
und Kreisbibliothekaren, den Buchhändlern, die oft aufgeregter sind als der
Autor, in Sorge, `dass auch ja alles klappt´. – Für mich hat es `geklappt´, wenn
ich Informationen und Unterhaltung gegeben habe und Anregungen für mein nächstes
Buch mitnehmen konnte.“
Die Rechtschreibung sämtlicher
Texte
wurde behutsam der letzten Rechtschreibreform angepasst.
Die
TSCHUKTSCHEN
wurden am 24.02.2014 ins Netz gestellt.
Die letzte Bearbeitung erfolgte am 25.01.2016.
Die Weiterverwertung der hier
veröffentlichten Texte, Übersetzungen, Nachdichtungen, Fotos, Zeichnungen,
Illustrationen... ist nur mit Verweis auf die Internetadresse
www.reller-rezensionen.de
gestattet -
und mit korrekter Namensangabe des jeweils genannten geistigen
Urhebers.

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring